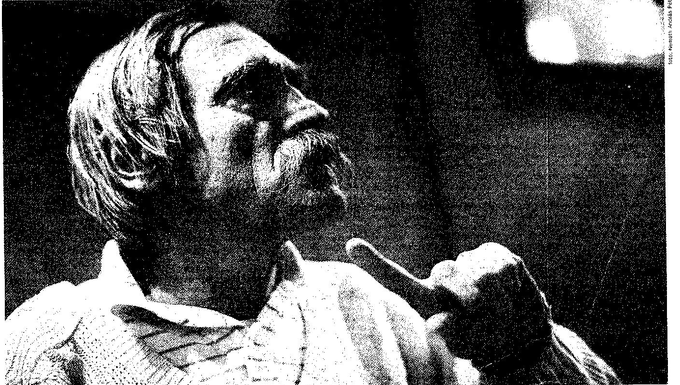241
Eine andere Gesellschaft
Abschied vom Monetozän
Wo wollen wir hin? Die Gesellschaft der Zukunft ist eine Gesellschaft freier, selbstbestimmter Menschen. Eine Gesellschaft von Menschen, die sich an den vielen kleinen Dingen des Lebens erfreuen und ihnen Sinn abgewinnen; egal ob sie als Jäger nach neuen, ungekannten Erlebnissen suchen, sich als Hirten um ihre Angehörigen, Freunde und die Hilfsbedürftigen kümmern oder als Kritiker die Gesellschaft überdenken und weiterdenken. Ganz gleich, ob man seinen Garten be-stellt, ein Großprojekt managt, seine Mitmenschen ermun-tert und aufheitert, sich um ihre Psyche oder ihren Körper kümmert — das Leben bietet mehr Würde, mehr Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten, als es das heute tut. Gelebt von verantwortungsvollen Menschen, die ihre echten Bedürfnisse von eingeredetem Bedarf unterscheiden können und die alles tun, um nicht auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben. Die Medizin hat sich weiter verbessert, die Lebenserwartung steigt, der stinkende Verkehr in den Städten ist einem lautlosen Gleiten gewichen. Mehr Pflanzen, mehr Grün, mehr Ruhe, Stille und Kontemplation haben Einzug in diese Lebenswelt gehalten, während im Hintergrund nimmermüde intelligente Maschinen den Volkswohlstand erwirtschaften. Die Hektik und der Stress der Arbeitswelt sind auf ganz leise surrende Maschinen übergegangen.
242
Wie wurde das — oder doch ein wichtiger Teil davon — geschafft? Erinnern wir uns an die merkwürdig unruhige Zeit, in der wir 2018 noch lebten. Auf der einen Seite verhieß uns eine aufsteigende Linie, dass die Menschen in den fortgeschritte-nen Ländern der Digitalität immer weniger für Geld arbeiten müssen. Dass jener Prozess, der mit der Zweiundachtzig-Stunden-Woche begann und heute in Deutschland bei 37,5 Stunden liegt, weiter fortschreitet und mehr und mehr Menschen davon befreit, aus existenzieller Abhängigkeit, Angst und Erpressbarkeit langweilige und wenig würdige Arbeit tun zu müssen. Die Möglichkeiten sich zu bilden und zu entfalten waren schon damals im historischen Vergleich schier gren-zenlos und übertrafen die kühnsten Träume der Aufkliirting. Auf der anderen Seite aber stand 2018 noch gleichzeitig diese ungeheure Bedrohung! Eine Linie, die steil nach unten führte: von der Mündigkeit und Autonomie, die int späten 20. Jahrhundert so weitgehend erreicht war, hin zu einer Gesellschaft, in der das Verhalten der Menschen mehr und mehr manipulativ gesteuert wird; eine Entwicklung, die das Begehren anreizte und einheizte auf Kosten reflektierter Urteilskraft; ein Driften, das kulturelle, ethische und politische Fähigkeiten verkümmern zu lassen drohte. Und das Menschen am Ende sogar dazu bringen sollte, einer Verschmelzung mit Maschinen zuzustimmen, sich Chips zu inplementieren, bis alles Menschliche überflüssig sein würde, alle Humanität ersterben sollte in einer Diktatur der Maschinen - der «Singularität«. Menschheitstraum und Albtraum im Jahr 2018 standen sie noch so nah beieinander. Aber war da nicht bei dem ersten und zweiten industriellen Revolution genauso? Das Schicksal der Arbeiter war entsetzlich, die Kapitalisten aber sahen darin kein Problem. Und selbst Marx glaubte, dies geht's so weiter bis zur totalen Massenverelendung. Man denke auch an 243
das zynische Menschenbild des Taylorismus in der zwei-ten industriellen Revolution, das für den Arbeiter nichts anderes vorsah als einfache Handbewegungen am Fließband in immer schnellerem Takt. Würde sich daran jemals etwas ändern? Die meisten Ökonomen zu Anfang des 20. Jahrhun-derts sahen keine Befreiung voraus. Man denke auch an die Sogkraft des Stalinismus mit seinem nicht minder zynischen Menschenbild, der sich selbst als das Ziel der Geschichte missverstand. Warum also sollte der »digitale Taylorismus«, die Reduktion des Menschen auf seine Daten und deren effiziente Ausbeutung, das Ende der Geschichte sein und nicht eine korrigierbare Übergangsphase im Umgang mit neuer Technologie? Es gibt viele Indizien dafür, dass nicht alles so geschieht, wie das Silicon Valley prophezeit. Denn gleich drei große Krisen zeichnen sich heute am Horizont ab. Ihre Erschütterungen dürften unsere bisherige Art zu wirtschaften nicht auf gewohnte Weise weitergehen lassen. Die erste Krise ist die Konsumkrise. Wo heute und in Zukunft die Produktivität der Wirtschaft erhöht wird durch digitales Rationalisieren und logistisches Optimieren, verlieren weit mehr Menschen ihren Beruf als neue Berufe entstehen können und sollen. Die Kaufkraft sinkt. Und da, wo die Konsumtion eingeheizt wird, durch systematisches Abschöpfen der Kunden, entsteht unterm Strich kein Wachstum, sondern nur eine allmähliche Verlagerung von den Kleinen zu den Großen. Weder der Produktivitätsgewinn noch der Konsumtionsgewinn der Großen kommen der Kaufkraft zugute. In diesem Sinne folgt die Digitalisierung jener Entwicklung, die bereits in den Siebzigerjahren eingesetzt hat, und beschleunigt sie: der systematischen Effizienzsteigerung der Wirtschaft ohne entsprechenden Durchschlag
244
in der Nachfrage auf den Binnenmärkten. Was Export, Verschuldung und Finanzkapitalismus lange im Dunkel halten konnten, droht nun offensichtlich zu werden: dass unsere Art zu wirtschaften nicht weiterhin zu einem realen Wachstum in unseren Volkswirtschaften führt. Schon jetzt nützen die enormen Bilanzgewinne der GA As der US-amerikanischen Volkswirtschaft ziemlich wenig. Soll-ten die auf künstlicher Intelligenz beruhenden zukünftigen Geschäftsmodelle — wie etwa das selbstfahrende Auto — marktreif sein, so versetzt das der darbenden US-amerikanischen Auto-mobilindustrie endgültig den Todesstoß. Das Gleiche gilt für ungezählte andere Disruptionen der Technik. Noch bevor die Situation in Ländern wie Deutschland dramatisch wird, wird sie es in den USA. Phänomene wie Donald Trump verraten schon jetzt das kommende Beben. Die technischen Utopien des Silicon Valley gedeihen nicht im luftleeren Raum. Produzieren sie volkswirtschaftliche Probleme oder gar Katastrophen, werden sie nicht linear oder gar exponentiell weiter gehen. Genau das ist das Motiv der Hightech-Konzerne und ihrer Großinvestoren, nach einem Grundeinkommen zu rufen. Aber wird es ihnen ihr Problem lösen? Das stärkste Argument gegen die schöne neue Welt, die uns die GAFAs und ihre Investoren ausmalen, ist, dass sie iikono misch, so wie verheißen, vermutlich nicht funktionieren wird. Zum einen sind viele Geschäftsmodelle reine An k ündigungs firmen. Der Fahrgastvermittler Uber macht jedes Jahr etwa eine Milliarde US-Dollar Verlust, ohne dass es seine groKen Kapitalgeber wie Saudi-Arabien oder Goldmail Sachs, die dir Welt gewiss jeden Tag ein bisschen besser machen wollen, merklich beunruhigt. Der Wert Ubers liegt nicht in seiner lii lanz oder in der veranschlagten Fantasiesminne von 60 Milliarden US-Dollar, sondern in den Hoffnungen der Spekulanten.
245
Und damit steht Uber in der Digitalwirtschaft nicht alleine da. Der Wert zahlreicher Digitalkonzerne speist sich aus den Träumen von »Vision Fonds« und anderen Venture Capital Fonds, die ihren Verheißungen Glauben schenken. Ob bei Airbnb, Wimdu oder im maßlos aufgeblasenen Bereich des E-Learning — rentable Geschäftsmodelle sind kaum irgendwo in Sicht. Wenn ökonomische Blasen dadurch entstehen, dass leicht verfügbare Kredite übermäßige Investitionen ermöglichen, die anschließend nicht aufgehen — so könnte der Weltfinanzkrise von 2007 bis 2009 schon bald eine gewaltige Di-gitalkrise folgen. Umso wichtiger ist es, dass Länder wie Deutschland sich nicht allzu sehr von der digitalen Konsumgüterwirtschaft abhängig machen, insbesondere wenn es um gewinnorientiere Dienstleistungen für jedermann geht. Die besten Motorsägen, Schrauben, Industrietextilien oder Rollkoffer herzustellen wird auch in der Zukunft Rückgrat der deutschen Wirtschaft sein. Der vom Silicon Valley vorgezeichnete Weg in die totale Technosphäre hingegen wird vermutlich schon aus wirtschaftlichen Gründen kein gradliniger sein. Zwar kann man versuchen, gut und gerne zwei Drittel der Bevölkerung mit virtueller Unterhaltung ruhigzustellen, um den sozialen Frieden zu sichern. Doch selbst wenn es gelänge, schafft das noch lange nicht genug Konsumkraft, um viele hundert Milliarden schwere Investitionen in die künstliche Intelligenz rentabel zu machen. Die digitale Ökonomie, zumindest dort, wo sie auf Konsum angewiesen ist, hat eine gewaltige Krux. Zu wenige Menschen verdienen in Zukunft noch genug Geld, um das System in bisheriger Weise am Leben zu erhalten. Gerade das dürfte der Grund dafür sein, dass so viele Profiteure des alten Systems die drohende Massenarbeitslosigkeit in den fortgeschrittenen Industrieländern kleinreden. Denn
246
sollte dämmern, dass der bisherige Weg so nicht weitergeht, weckt dies unweigerlich den Sinn dafür, über grundsätzliche Alternativen nachzudenken. Und genau daran zeigen die großen Wirtschaftsverbände auch in Deutschland gegenwärtig wenig Interesse. Damit ist bereits die zweite Krise angesprochen. Viele Menschen werden ökonomisch in Zukunft zwar noch als Konsumenten gebraucht — aber eben nur noch als Konsumenten. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari gibt sich in seinem Buch Homo Deus viel Mühe zu zeigen, dass sich das freiheitliche Menschenbild der Aufklärung erst dann durchsetzte, als man sich sowohl militärischen als auch ökonomischen Profit davon versprach. Als die Söldnerheere der Wehrpflicht wichen und die Menschen in den Fabriken gebraucht wurden, verlieh man ihnen Rechte und erklärte sie zu Individuen, weil man sie als solche brauchte. Man wird dieser These nicht treu folgen müssen. In den Fabriken des frühen 19. ,Jahrhunderts wurden nämlich gerade keine Individuen gebraucht, und die Erklärung der Menschenrechte diente gewiss nicht ausschließlich der Motivation des Bürgers in Uniform. Doch hat Harari nicht zumindest in seiner Folgerung recht, dass Moral und ka pitalistische Ökonomie im Liberalismus ein Bündnis auf Zeit eingingen, das in der Zukunft so nicht mehr notwendig ist? »Wenn die Massen ihre wirtschaftliche Bedeutung verlieren, mögen Menschenrechte und Freiheiten weiterhin moralisch gerechtfertigt sein, aber werden moralische Argumente atisrei chen? Werden Eliten und Regierungen jedem Menschen w ter einen Wert zuschreiben, selbst wenn er sich ökonomisch nicht bezahlt macht? ... Menschen stehen in der Gefahr, ihren ökonomischen Wert zu verlieren, weil sich Intelligenz von Bewusstsein abkoppelt.«" Wer sich das Menschenbild des Silicon Valley ansieht, das
247
Menschen für ein Konglomerat von Daten hält, für einen defizitären Computer auf der Suche nach Schnittstellen zur digitalen Technik, die ihn vom Menschsein erlösen, der wird Hararis Befürchtung schnell teilen. Denn wer unbegrenzten Handel mit dem in Daten gesammelten Leben von Menschen treibt und Politik durch Sozialtechnik ersetzen möchte, dabei noch lächelnd behauptet, die Welt besser zu machen, dem ist im Hinblick auf Humanität und Menschenrechte nicht viel Gutes zuzutrauen. Gut möglich also, dass Harari recht hat. Eine alte Gesellschaft, entstanden in der ersten industriellen Revolution — die Liaison von liberal-kapitalistischer Ökonomie und den freiheitlichen Grundwerten der Aufklärung —, geht zu Ende, weil ihre Grundlage, die bürgerliche Arbeits-und Leistungsgesellschaft, verschwindet. Die These, schon früh in diesem Buch gezeichnet, hat jetzt ihr tieferes Relief erhalten. Doch was kommt danach?
Konsumkrise und — nennen wir sie — liarari-Krise sind kei-ne kleinen Irritationen auf dem Weg des »Weiter so«. Sie sind Anzeichen eines Umbruchs entweder in unserem freiheitlichen Menschenbild oder in unserer Art zu wirtschaften. Erst wenn man erkennt, dass wir vor einer solchen Entscheidung stehen, versteht man die Lage. Der Hyperkapitalismus des Silicon Valley kann nicht länger so funktionieren wie bisher und dabei gleichzeitig die Werte der Aufklärung hochhalten, es sei denn als Maskerade. Die aufsteigende Befreiungslinie (der Weg des Menschen vom Lohnsklaven zum selbstbestimmt tätigen Menschen) und die absteigende Entmündigungslinie (das allmähliche Ersetzen menschlicher Urteilskraft durch Programmcode) können nicht unbegrenzt in gegenläufiger Richtung weiterge-hen, ohne dass das System auseinanderfliegt.
248
Verstärkt werden diese Turbulenzen noch durch die dritte, die ökologische Krise, die in ihrer Gesamtdimension die beiden anderen weit übertrifft. Unser gesamtes, inzwischen immer globaleres Wirtschaftsmodell ist noch im Jahr 2018 auf unendliches Wachstum ausgerichtet und nach wie vor auf schonungslose Ausbeutung von Ressourcen und höchste Belastung des Klimas. Dass wir das nicht fortsetzen dürfen, wissen im Grunde alle, aber im Alltag glauben wir es irgendwie nicht, jedenfalls ziehen wir keine ernsten Konsequenzen daraus. Der Kapitalismus, so heißt es, muss wachsen. Sollte das stimmen, so wird er wohl noch in diesem Jahrhun-dert die Erde weitgehend unbewohnbar machen. Das Viertel der Menschen, das in den reichen Industrieländern lebt, ver-braucht gegenwärtig drei Viertel der Ressourcen der Welt, und die meisten davon sind endlich. In diesem Sinne ver-stärkt die Digitalisierung eine unheilvolle Entwicklung. Digitale Technik benötigt meist sehr viel Energie. Allein die Technologie für die Kryptowährung Bitcoin verbraucht im Jahr fast so viel Strom wie der gesamte Staat Dänemark!'" Google, Facebook und Co. können alles — nur nicht den K lima wandel stoppen, den Welthunger bezwingen oder die Bodenschätze und das Trinkwasser vermehren. Sie können nicht mal aus der Wachstumsspirale ausbrechen. Selbst wenn Google inzwischen effizienter mit seinem Energieverbrauch umgeht — gemessen an immer mehr und immer energiehungrigerer digitaler Technik fällt dies kaum ins Gewicht. So treibt die Digitalisierung die Ressourcenausbeutung und den Klimawandel stets weiter voran. Besonders prekär an den drei Krisen ist, dass man nichts im Gleichschritt gegen sie tun kann. Wenn es rieht ist, dass gemessen an der anwachsenden Produktivität der Konsum zu gering ist, dann wäre die Lösung mehr Konsul». So etwa plä-
249
diert der Ökonom Heiner Flassbeck dafür, einfach die Löhne stärker zu erhöhen, und alles sei wieder im Lot. (92) Doch die Rezepte von gestern lösen nicht die Probleme der Zukunft. Sie verschließen die Augen vor dem ökonomischen Umbruch der Arbeits- und Leistungsgesellschaft, den sie gerne klein-reden, weil er nicht in ihr Schema passt. Und sie verfechten weiter jene konsumistische Ideologie, die wir so dringend überwinden müssen. Wie gezeigt, trägt gerade der Hyperkonsumismus, der heute schon die reichen Länder prägt, zu einer mangelnden staatsbürgerlichen Mentalität bei, erzeugt »ungeduldige und faule« Konsumenten und heizt die ökologische Katastrophe immer weiter an! Mit anderen Worten: Um die Konsumkrise zu beheben, müsste man die Öko-Krise verschärfen! Ist es angesichts solch einer monumentalen Herausforde-rung zynisch, das im Silicon Valley so beliebte Motto der Stanford University zu zitieren: »livery problem is an opportunity. The bigger the problem, the bigger the opportunity«? Wie bei jeder Zeitenwende sind große Unruhen zu befürchten, und bereits bestehende Unruhe wird weiter ver-stärkt. Wenn der Kitt bröckelt, fliegen die Späne in alle Richtungen. Die Ausschläge werden sich in die Winde verteilen: als Millionen von Menschen, denen der Klimawandel immer rasanter die Lebensgrundlagen entzieht, als riesige Migrationsbewegungen, als blindwütiger völkischer Nationalismus, als Separatismus, als Protektionismus, als Empörungs- und Hasskultur im Internet, als Parteienverdrossenheit, in Ablenkungskriegen, als Zuflucht zu Verschwörungstheorien und als Milizenbildung mit Pogromen (in den USA, aber vielleicht nicht nur dort). Die Situation deutet auf große Umwälzungen hin. Warum sollte sie auch nicht? Die erste und zweite industrielle Revo-
250
lution veränderten die Gesellschaften ebenfalls radikal, von der Entstehung des Proletariats über die Arbeiterbewegung bis zum Frauenwahlrecht. Doch ob die Gesellschaft der Zukunft besser oder schlechter wird, ist nicht ausgemacht. Auch ein Rückfall in die Barbarei ist jederzeit denkbar, ausgelöst durch große Volksverführer. Andere schielen nach China, dessen digitaler Kontrollkapitalismus immer weiter voranschreitet und ökonomisch äußerst erfolgreich ist. Brauchen wir das in Europa ebenso, weil wir sonst den Wettbewerb verlieren? Doch dass der sich stets weiter entfesselnde Kapitalismus, der im 21. Jahrhundert mit Billionensummen in Geschäftsmodel-le investiert, die unsere Freiheit bedrohen und unsere Umwelt rasant zerstören, nicht das Gute ist, ist heute ziemlich breiter Konsens. Nicht nur im Keller der Unzufriedenen und Arbeits-losen, nicht allein in den Dachstuben der armen Poeten und linken Intellektuellen, selbst in der Beletage der Konzernlenker und »Entscheider« wächst das Unbehagen. Für den US-Großinvestor George Soros sind Google und Facebook Monopolisten, »die Sucht fördern, unabhängiges Denken bedrohen und Diktatoren eine staatlich finanzierte Überwachung ermöglichen«. Die offene Gesellschaft sei in der Krise, die Demokratie bedroht, ja das Überleben der Zivilisation stehe auf dem Spiel." Seit den Tagen des US-amerikanischen Philosophen johlt Rawls lautet das Credo der Liberalen, dass Ungleichheit Staat nur dadurch gerechtfertigt ist, dass die Schwächsten davon noch den größtmöglichen Vorteil haben. Niemand wird das über die GAFAs oder die Profiteure der globalen Finanzindustrie sagen können, niemand über die immer irreren Gehälter von Fußballspielern. Wenn laut Oxfain-Bericht die zweiundsechzig reichsten Menschen der Welt so viel besitzen wie die 3,6 Milliarden ärmsten, dann ist der globale Kapitalismus
251
nicht mehr die beste aller möglichen Welten, sondern befindet sich auf rasant abschüssiger Fahrt. Kein Selbstkorrekturme-chanismus hält ihn dabei auf und auch keine nationale Regierung. Doch der hohl drehende Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen, wird nicht durch eine Revolution mit Fahnen und Barrikaden abgelöst. Wenn erzerbricht, dann eher durch die technische Revolution, die ihm sein Fundament entziehen könnte, und durch gute Ideen, die seinen Widersprüchen ent-springen. Doch was wird auf ihn folgen? Die linke Literatur zur Digitalwirtschaft ist voll mit Tex-ten, die Karl Marx' Prophezeiung, dass der Kapitalismus zusammenbricht, in Kürze eintreffen sehen; allerdings nicht jene frühe Vision von der Revolution der Proletarier, sondern die späte aus dem dritten Band des Kapital: dass die Profitrate der kapitalistischen Wirtschaft ständig weiter fällt, je effizien-ter sie produziert, und dass das irgendwann eine Systemkrise auslöst. Das Finanzkapital mag noch so sehr ins Silicon Valley investieren, einen nachhaltigen Durchschlag auf die Konsum-wirtschaft hat das nicht. Und je höher technisiert die Digitalwirtschaft wird, umso günstiger würden zugleich ihre Produkte, bis sie am Ende keine Rendite mehr abwerfen. Würde man die Schutzzäune einreißen, die die großen Monopolisten der Digitalwirtschaft um ihre Geschäftsmodelle errichtet ha-ben, so wäre das schon heute der Fall. Warum sollten soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Sprachassistenten und auch das Internet der Dinge nicht Gemeineigentum sein? Je mehr alles Wissen demokratisiert wird, umso weniger bedürfe es noch der Kapitalisten, die gewinnorientierte Geschäftsmodelle damit betreiben. Wissen und Kommunikation sollten, so hatte Marx bereits 1858 gefordert, nicht nur »Mittel« des Kapitals sein. Sie müssen allen gehören. Und wenn sie das tun, dann »sprengen« sie den Kapitalismus damit »in die Luft«. (94)
252
Doch ganz so logisch und sicher, wie manche es sich wünschen, ist das nicht. Denn selbst wenn die Silicon-Valley-Blase, die sich derzeit im Eiltempo bildet, platzt, ist es zunächst nur eine geplatzte Blase unter vielen in der an Blasen nicht armen Geschichte des Kapitalismus. Und gegen den Fall der Profitrate sind die Kapitalisten schon immer sehr kreativ vorgegangen, durch globalisierte Märkte, Kriege und die unerschrocke-ne Vermehrung von realem Geld und fiktivem Kapital. Die zweite Frage ist, wer im Fall eines Crashs das Heft des Handelns in die Hand nehmen müsste, um kapitalistische Geschäftsmodelle in eine Gemeinwohlökonomie umzuwandeln. Das »Proletariat« sicher nicht. Also die US-amerikanische Regierung oder vielleicht die Europäische Union? Nicht allzu wahrscheinlich. Ein Aufstand der Bürger, insbesondere der gebildeten Mittelschichten? Ja, ganz, ganz vielleicht. Aber was für ein System sollen sie optimalerweise errichten? Einen Sozialismus? Wie die Geschichte lehrt, mündet jeder Sozialismus in Reinform entweder in eine Staatsdiktatur oder in eine Anarchie, in der sich am Ende wieder die Stärksten und Rück-sichtslosesten zu neuen Oligarchen aufschwingen. Der realistische Weg ist nicht die Abschaffung des Kapitalismus. Weder existiert dafür ein »revolutionäres Subjekt«, noch ist der Sozialismus als Blaupause eine Alternative für das gesamte Wirtschaften. In den Jahren 1883/1884 hatte Otto von Bismarck mit seiner Sozialgesetzgebung die Nachtseite der ersten industriellen Revolution aufgehellt und den Manchester-Kapitalismus etwas entübelt. Und in den Dreißip,erja hren hatten die Denker der »Freiburger Schule« sozialistische Elemente in den Kapitalismus eingebaut, um ihn all rak t ver und beständiger zu machen im Systemwettbewerb mit dem K om-
253
munismus — die Geburtsstunde der sozialen Marktwirtschaft. Ihre Konzepte zivilisierten die zweite industrielle Revolution und schufen die Grundlage der höchst erfolgreichen deutschen Ökonomie nach 1948. Im Angesicht der vierten industriellen Revolution stehen wir wieder vor der Aufgabe, unter veränderten Wirtschaftsbedingungen eine neue Ordnung und Balance herzustellen, also einen neuen Gesellschaftsvertrag abzuschließen. Wir werden wieder mehr Sozialismus in den Kapitalismus implementieren müssen, um die aufsteigende Linie von Bismarck über die Freiburger Schule fortzusetzen —oder aber wir riskieren gewaltige ökonomische und gesellschaftliche Crashs. Ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen ist dazu ein erster Schritt — auch wenn linke Kritiker, wie der Publizist Mathias Greffrath, darin leider noch immer nur einen Versuch sehen können, wirtschaftlich überflüssigen Menschen die »Würde der Almosenempfänger« zu sichern.`'' Ein solcher altlinker Abwehrreflex springt zu kurz. Tatsächlich nämlich befreit ein angemessen hohes Grundeinkommen viele Millionen Menschen von dem Diktat, nach den Spielregeln einer Gesellschaft zu funktionieren, die ihr Wirtschaften als »Leistungsgesellschaft« tarnt und Menschen psychologisch dazu zwingt, sich in diese Ordnung einzugliedern. Das BGE ist mehr Freiheit durch Sozialismus. Mit ihm dürfte sich bei vielen Menschen der Fokus tatsächlich darauf richten, wie und für wen man arbeitet — der Einstieg in eine Gesellschaft der Jäger, Hirten und Kritiker der Zukunft. Wie die Arbeiterbewe-gung im 19. Jahrhundert, so muss auch die »Nicht-Arbeiterbewegung« des 21. Jahrhunderts Humanität zurückgewinnen, die im bedingungslosen Effizienzstreben der Wirtschaft bereits 'Terrain verloren hat und noch viel mehr zu verlieren droht. Natürlich ist das Grundeinkommen nicht die Lösung, son-
254
dern nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft der Zukunft. Ein anderes Bildungssystem ist ebenso notwendig wie die Zivilisierung der Digitalwirtschaft, die langfristig den Menschen dienen muss und nicht der Mensch ihr. Wenn die Illusion des Perpetuum-mobile-Kapitalismus platzt, wird klar, dass Effizienzsteigerung in der Produktion Wirtschaft und Gesellschaft nicht viel nützen, wenn sich nicht vieles andere auch ändert. Ein Bewusstseinswandel. im Umgang mit der digitalen Technik und ihren Geschäftsmodellen ist dabei viel leichter vorstellbar, als viele Pessimisten glauben, die sich in die große Erzählung des Silicon Valley ha-ben einspinnen lassen, dass die Zukunft vorherbestimmt sei. Doch wer sagt, dass uns die Prädestinationslehre vom Weg in die Diktatur der Technik nicht schon bald so albern erscheint, wie sie ist? Man schaue nur einmal, welcher Bewusstseinswandel in Ländern wie Deutschland bereits möglich war. Wie gewaltig haben sich das Bewusstsein und die Weltsicht der Deutschen von den Fünfzigerjahren bis heute geändert! Die Welt der Hosenträger und Heinz-Erhardt-Witze, der Fräuleins vom Amt und der langen Arbeitszeiten erscheint heutigen Jugend-lichen als eine Erzählung aus der Zeit von Asterix; nicht anders die Welt der Siebziger und Achtziger. Warum sollte das Bewusstsein in den nächsten Jahrzehnten nicht ähnlich fortschreiten? Wer hatte schon in den Sechzigern ein Gefühl dafür, dass wir unsere Umwelt bewahren müssen? Und wem fehlt es heute — außer den größten Verantwortlichen vielleicht? Wie der Umweltschutz der Bio- und Ökobewegung bedurfte, so bedarf der Umgang mit der Technik einer Bewegung für hu-mane Technologie und humanen Technologieeinsatz. Gewiss reicht das nicht aus. Gesellschaftliche Unibrüche üche bedürfen der Katastrophen — aber auf die dürfte auch diesmal Verlass sein. Allen voran die sehr wahrscheinlich anstehende
255
Massenarbeitslosigkeit. Sie wird die Politik von der Lethargie zur Einsicht und dann zum Handeln zwingen. Wenn die Not groß und die Empörung der Medien gewaltig ist, wird klar, dass Geschäftsmodelle, die vielen alternativlos erscheinen, es nicht sind. Dass es viele Möglichkeiten gibt, mit dem Internet, mit Daten und künstlicher Intelligenz umzugehen, und nicht eine einzige. Dass der Staat gefordert ist, selbst viel aktiver auf den Plan zu treten, zu regulieren, Anreize richtig zu setzen und den Sozialstaat komplett umzubauen. Und dass er die Menschen nicht orientierungslos lassen darf beim Übergang von der klassischen Arbeits- und Leistungsgesellschaft zu einer neuen Gesellschaft.
Die Aufgabe der Politik für das Jahr 2018 und darüber hi-naus ist damit klar umrissen. Sie muss ihre Selbstverzwergung überwinden, aus ihrem »pragmatischen Schlummer« erwachen und die Dinge wieder unter Kontrolle kriegen, die sie hat schleifen lassen. Der sogenannte freie Markt wird es nicht re-geln, und in der Internetwirtschaft ist er angesichts billionenschwerer Monopolisten ohnehin nicht frei. Politiker müssen zeigen, was ihnen das freiheitliche Menschenbild der Aufklä-rung wert ist, und das Recht aller Bürger auf informationelle Selbstbestimmung entsprechend sicher schützen. Denn fast unbemerkt von unseren Ordnungs- und Verfassungshütern ereignet sich im Silicon Valley, der Brutstätte der Techno-Utopie, ein Prozess, der zuvor bereits den Kommunismus mora-lisch ruiniert hat. Aus dem solutionistischen Versprechen, die Welt besser zu machen, droht ein unkontrollierbarer Macht-apparat zu werden, der alles kontrolliert. Dagegen müssen wir uns wehren und schützen. Unsere Po litik er und Verfassungsrichter müssen ein Menschenbild verteidigen, das Verhalten nicht auf Algorithmen und Leben nicht auf
256
Datenverarbeitung reduziert. Dieser Freiheitskampf wird nicht in Sonntagsreden entschieden, sondern in Regulierungen und in Investitionen in eine Wirtschaft, die nicht auf vergleich-bar ideologische Weise mit Menschen umgeht. Die Zeiten des Schlafwandelns und des Mitmachzwangs sind vorbei und das Internet für keinen Politiker mehr »Neuland«. Menschen wie Mark Zuckerberg, der sein Privatleben in Palo Alto hinter einer Firewall aus dazugekauften Grundstücken und Häusern verbirgt, wissen, was sie tun; Menschen, die ihm Glauben schenken, wenn er vom Wert schier unbegrenzter Datentransparenz schwärmt, nicht. Doch wie zivilisiert man den Digitalkapitalismus ganz konkret? Geht es nach dem US-Ökonomen Scott Galloway, so bliebe heute nichts anderes übrig, als Google, Facebook, Amazon und Apple schlichtweg zu zerschlagen, um wieder echten Wettbewerb herzustellen. Durchaus möglich, dass die US-Regierung in absehbarer Zeit zu diesem Mittel greift. Es wäre nicht das erste Mal. Doch ändert es wirklich allzu viel am Problem, wenn es statt einem Facebook vier und statt einem Google drei gibt? Die Geschäftsmodelle bleiben damit ebenso wenig angetastet wie die Geschäftspraktiken und Ideo-logien. Auch wenn die Macht im Silicon Valley anders verteilt wird, gibt es die Gefahr, dass solutionistische Lösungen und Programmcodes unser Leben stillstellen, unsere Entwicklungs-möglichkeiten behindern und unsere Demokratie abschaffen. Die grundlegendere Frage der digitalen Zukunft lautet: Wem gehört was? Und warum? Meine Daten sollten jedenfalls mir gehören. Und die digitale Infrastruktur im Netz ist viel zu wichtig für die Freiheit und Entfaltung jedes Einzelnen, als sie unberechenbaren privaten Unternehmen zu überlassen. Hier ist der Staat gefordert, um eine Grundversorgung zu er-
257
möglichen, die er ähnlich wie unsere Straßen und unsere Ener-gieversorgung nicht den Geschäftsinteressen Dritter ausliefern darf. Was auch immer demnächst an digitalen Agenden verabschiedet wird: Die Freiheit der Bürger im Netz zu gewährleisten muss ihr Mittelpunkt sein. Interessant sind dabei auch die wirtschaftlichen Folgen. Ein freies Internet enthält eine Menge Potenzial, für jeden produktiv zu sein. Karl Marx hatte in seiner berühmten Unterscheidung von Produktivkräften und Produktionsmitteln gesprochen. Produktivkräfte sind alle die, die etwas herstellen, also die Arbeiter und die Maschinen. Die Produktionsmittel sind die Institutionen, Gesetze und Besitzverhältnisse, die darüber bestimmen, wem was gehört. In der ersten und zweiten industriellen Revolution waren beide streng getrennt. Die Maschinen und Fabriken gehörten nicht den Arbeitern, sondern entweder privaten Profiteuren oder, wie im Staatskapitalismus, dem Staat. In der digitalen Welt hingegen ist ein ganz anderes Szenario möglich. Warum sollte beides weiterhin so klar getrennt sein? Mein Laptop oder mein Smartphone gehören mir, und warum sollte das nicht auch für meine Arbeitsleistung gelten? In einer Welt des allseits verfügbaren Wissens und sehr billiger Maschinen mit enormen Fähigkeiten ist die alte Trennung bei Weitem nicht mehr so naheliegend wie noch in der alten Welt der Dampfmaschinen und Fließbänder. Wenn man zudem bedenkt, dass in Zukunft immer weniger Menschen fest angestellt arbeiten werden, fragt man sich unweigerlich, warum die Crowdworker der Zukunft ihre Arbeitskraft eigentlich für ein digitales Großunternehmen einsetzen sollen, statt für sich selbst oder eine Gemeinschaft. Koope-rationen und dezentrale Netzwerke sind heute auf ganz neue Weise möglich, anders als in den ersten beiden Jahrhunderten seit der Erfindung der Dampfmaschine. Wenn der Staat will,
258
dass die vielen Millionen Menschen, die in Zukunft keiner an-gestellten Erwerbsarbeit mehr nachgehen, Projekte machen, die ihnen und der Gesellschaft dienen, so muss er alles dafür tun, Open-Source- und Open-Content-Projekte zu ermöglichen, insbesondere jene, die gemeinwohlorientiert sind. Für viele, die in den nächsten Jahrzehnten als Versicherungsvertreter oder Busfahrer ihren Job verlieren, ist das nicht allzu tröstlich. Wohl aber schafft es vielen jungen Leuten eine Perspektive, statt unbefriedigender Arbeit in der herkömmlichen Digitalwirtschaft sich für sich selbst, ihre Community und die Gesellschaft einzusetzen. Das Zauberwort dafür lautet »Allmendeproduktion«. Die Allmende war das mittelalterliche Gemeinschaftsland, auf dem die Bauern in den Dörfern und Städten arbeiteten, bevor Großgrundbesitzer es ihnen wegnahmen. So ist Wikipedia eine Allmendeweide, auf der jeder seine Schafe weiden lassen kann und auf der zum Nutzen aller gearbeitet wird. Zwar zeigt ein kleiner Blick hinter die Kulissen eine äußerst unglei-che Verteilung der dortigen Deutungsmacht, doch das Prinzip erscheint gleichwohl ehrenwert. Linke Utopisten haben sich inzwischen sehr weitreichend in die Idee verliebt, Allmendewirtschaft gepaart mit einem öffentlichen Internet der Dinge löse alle ökonomischen Probleme. Doch ob das tatsächlich die Matrix künftiger Ökonomie in den reichen Ländern der Erde sein soll, ist bislang ein schöner Traum, geträumt aus rotem Mohn. Gegenwärtig jedenfalls zerstören Geschäftsmodelle des Valleys wie Uber und Airbnb genau jene für die "Zukunft so wichtige Welt der unentgeltlichen sozialen Dienste und Imm-merzialisieren sie bis in den kleinsten Winkel. So wie der Perpetuum-mobile-Kapitalismus nicht funktioniert, so gewiss auch nicht der Perpetuum-mobile-Sozia1is-mus, von dem schon Oscar Wilde träumte. Irgendwo in der
259
Welt werden weiterhin Seltene Erden für Smartphones ausge-graben werden und tobt der erbitterte Kampf um Rohstoffe. Captain Picards Welt ohne Geld, in der alles aus dem 3D-Drucker kommt, wird wohl tatsächlich erst im 24. Jahrhundert anbrechen. Und weder Kryptowährungen noch Allmendepro-, duktion sind der kürzeste Weg dorthin.
All das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass ein Grund-einkommen, gepaart mit mehr und mehr Gemeinwohlökonomie, nicht ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist — eine Richtung, die schon aus ökologischer Perspektive vorgezeichnet ist. Unsere Gesellschaft muss ihre Wirtschaft und ihre Mentalität so wandeln, dass wir nicht mehr so viel brauchen und mehr teilen, weil unsere Enkel sonst nicht mehr auf diesem Planeten alt werden können. Wir brauchen mehr Bildung in Menschlichkeit. Wir müssen einen klugen Umgang mit der digitalen Technik pflegen, lernen, ihren Stellenwert richtig einzuschätzen, ihre begrenzte binäre Logik verstehen und auch die Grenzen ihrer Übertragbarkeit auf soziale Prob-leme. Die Parteien müssen »das Andere« der Technik in den Mittelpunkt ihrer Wahlprogramme stellen, um die Werte der Aufklärung zu verteidigen. Der Wandel der klassischen Arbeits- und Leistungsgesellschaft in eine Welt aus Automation und selbstbestimmter Tätigkeit verlangt dem Staat also vieles ab. Zusammengefasst:
• den grundlegenden Umbau des Sozialsystems und die Schaf-fung eines bedingungslosen Grundeinkommens von min-destens 1500 Euro, finanziert durch Mikrosteuern, • die Sicherung der Würde der Bürger, insbesondere ihres Rechts auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestim-mung durch klare Regulierung und eindeutige Gesetze im Sinne von E-Privacy,
260
*das Bereitstellen einer digitalen Grundversorgung durch staatliche Förderung von Suchmaschinen, E-Mail-Verkehr, Sprachassistenten und sozialen Netzwerken ohne kommer-zielle Interessen, • eine weitreichende Kontrolle von Geschäftsmodellen der künstlichen Intelligenz und ihre Reglementierung unter Ein-bezug der Bürger — insbesondere dann, wenn Gesellschafts-bereiche durch Programmcodes ersetzt werden sollen, die ethisch sensibel sind, • die Förderung innovativer Ideen für die zukünftige Gestal-tung des Zusammenlebens, sozialer Start-ups, von Koope-rationen, Sharing-Economy-Modellen und Ideen zur Nach-haltigkeit und zur Gemeinwohlökonomie, • eine ernsthafte Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und zur Schonung der natürlichen Ressourcen auch und gerade an-gesichts digitaler Innovationen.
Für all das haben wir nicht Zeit bis zum Jahr 2040. Das meiste davon wird in den nächsten zehn Jahren entschieden werden müssen, um die Utopie eines guten und vielleicht sogar besseren Lebens zu ermöglichen. Noch sind die im Bundestag vertretenen Parteien Schlafwandler, beschäftigt vor allem mit sich und hilflos im Blick auf die Zukunft. Möge dieses Buch ihnen helfen, sich ein wenig besser zu orientieren. Wir leben heute in einer Zeit, die die Geologen das Anthro-pozän nennen: das Zeitalter des Menschen. Die Bezeichnung ist irreführend. Unsere Zeit mag jene der Menschen sein, aber sie dient ihnen nicht, sondern sie dient dem Geld, der instrumentellen Vernunft und dem Verwertungsdenken. Noch leben wir nicht im Anthropozän, sondern im Monetozän — dem Zeitalter des Geldes. Doch niemand ist gezwungen, sich damit abzufinden. Das Erbe der Aufklärung ist, sich die Zukunft als
260
vorn Menschen gestaltet zu denken und sie nicht in die Hand Gottes oder die Hand einer eigengesetzlichen Evolution von Technologie zu legen. Aufgeklärte Gesellschaften sind selbst-bestimmt und nicht fremdbestimmt, ferngesteuert durch Gott, das Kapital oder die Technik. Holen wir uns unsere Autonomie zurück — nicht nur in unserem Interesse, sondern vor allem im Interesse aller künftigen Generationen!
265
NACHTGEDANKEN
Wir und die anderen
Die Digitalisierung trifft die ganze Welt
Thomas Morus hat seine Utopia nicht beendet, ohne auf all die Skrupel hinzuweisen, die er beim Schreiben hatte. So bekennt er, dass ihm zum Schluss »allerlei zu Sinne« kam, was ihm bei allem, was er »geschrieben habe, ungereimt erscheint«. Und sein Büchlein, die modernste und humanste Vorstellung vom Zusammenleben des Menschen, die bis dahin entworfen wurde, endet nicht mit einer Prophetie, sondern mit ehrlichen Worten über seinen Idealstaat: »Freilich wünsche ich das mehr, als ich es hoffe. « (96) Wie sehr kann ich mich dem nur anschließen! Wie oft ist das, was in der Maske einer Antwort daherkommt, in Wirk-lichkeit eine Frage. Und wie oft erscheint in grübelnder Nacht unklar und ungereimt, was am Tag einfach und sonnenklar zu sein scheint. Phasen übler Befürchtungen und großer Niedergeschlagenheit wechselten in diesen grauen Wintertagen des Jahreswechsels von 2017 zu 2018 mit frühlingshaftem Optimismus. Den einen werden meine Vorschläge zu radikal, gar technikfeindlich sein. Unterschätze ich nicht gewaltig, zu welchen Hunderttausenden ungekannten neuen Berufen die Digitalwirtschaft führt? Und übertreibe ich nicht maßlos, wenn ich mir Sorgen um die Freiheit und Autonomie unseres zukünftigen Lebens mache? Den anderen hingegen gehen meine Ideen nicht weit genug. Wo bleibt die Abschaffung des Finanzkapi-
266
talismus, wo die zukunftsverändernde Kraft von Krypto- und Regionalwährungen, wo das Ende des Geldes überhaupt oder gar ein bedingungsloses Höchsteinkommen? Wo die Träume der einen einen immer erfolgreichen Kapitalismus sehen, möchten die anderen ihn lieber heute als morgen abschaffen. Träumen kann man viel. Für dieses Buch war es mir wichtig, den Weg der Utopie mit einem Traktor zu befahren — und nicht mit einem Luftschiff. Und die Befürchtung, nicht weit ge-nug oder zu weit gegangen zu sein gehörte noch zu den kleinen Sorgen. Besonders fatal wurde es stets, wenn die Gedanken in die Weite schweiften, heraus aus dem Wohlstandskokon Deutschlands und der reichen europäischen Staaten. Denn die Digitalisierung betrifft ja nicht nur die technisch am höchsten entwickelten Länder, sondern alle. Regionen wie Südostasien, die in den Siebziger- und Neunzigerjahren zu verlän-gerten Werkbänken der europäischen und US-amerikanischen Industrie wurden, können in Zukunft nicht mit den weitaus billigeren Robotern in Deutschland konkurrieren. Die ersten Textilfirmen brechen dort bereits ihre Zelte ab und produzieren wieder in Deutschland. Und was machen die Hunderte Millionen Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern, die weltweit von der Viehwirtschaft und der Tierfutterproduktion leben, wenn wir unser Fleisch in der Petrischale züchten, um die Gräuel der Massentierhaltung zu beseitigen? Ein bedingungsloses Grundeinkommen werden diese Länder sich nicht leisten können. Während die Industrienationen darüber nachdenken, wie sie weiterhin die Gewinner bleiben können, vergrößern sie den Abstand zu den armen Ländern und produzieren Verlierer. Die Folge sind Migrationsströme ungekannten Ausmaßes, denen gegenüber die Geflüchteten der letzten Jahre ein kleines Vor-beben waren. Über Jahrtausende folgten die Menschen den
267
Tierherden, heute folgen sie den Kapitalströmen. Doch die große Automation wird ihnen voraussichtlich nichts anbie-ten, wovon sie zukünftig leben können. Die digitale Revolution birgt so viel Potenzial für viele Men-schen, ihr Leben selbstbestimmter, informierter und vernetzter zu entwickeln in einer nachhaltigen Ökonomie, die ökologischer und sauberer produziert und dabei — anders als unsere heute — nicht nur an Innovation denkt, sondern auch an die Exnovation — an die Kosten für die Entsorgung ehemals in-novativer Innovationen. Doch werden wir unser Wirtschafts-system derart grundlegend verändern können? Und werden wir wirklich teilen? Mal abgesehen von der Frage, ob wir glücklich sein werden, wenn wir so leben, wie die optimisti-schen Visionäre unserer wirtschaftlichen Zukunft es uns ver-heißen — das 21. Jahrhundert wird vor allem das Jahrhundert sein, in dem wir unseren Wohlstand mit jenen teilen müssen, auf deren Kosten wir ihn zum Teil erarbeitet haben und weiter erarbeiten. Die Menschenrechte wurden im 18. Jahrhundert erklärt, im 19. Jahrhundert wurden sie in Europa partiell akzeptiert, im 20. Jahrhundert hier weitgehend verwirklicht. Das 21. Jahrhundert wird dasjenige sein, in dem wir sie glo-bal ernst nehmen müssen. Sich zur Aufklärung zu bekennen darf nicht heißen, bei Europa aufzuhören. Menschenrechte stehen allen Menschen zu. Mehr teilen und dabei zugleich die Ressourcen schützen —wird das im globalen Maßstab überhaupt möglich sein? Und laufen wir nicht Gefahr, Biologie und Ökologie nicht mehr zu sehen, wenn wir in immer digitaleren Welten leben? Spüren wir diese Verantwortung für uns und die anderen Tiere auf unserem Planeten? Eigentlich müssten Menschen und Tie-re in der Zukunft viel näher zusammenrücken, als biologi-sche und emotionale Wesen — als das Andere der künstlichen
268
Intelligenz. Natur und nicht Technik zu sein, ist dies nicht das Gefühl, das einen beschleicht, wenn man das Titelbild dieses Buchs betrachtet? »Die Schlangenbeschwörerin« von Henri Rousseau aus dem Jahr 1907; ein Naturidyll, gemalt zur Zeit der zweiten industriellen Revolution, von einem Bretonen in der Pariser Vorstadt, der nie ein tropisches Paradies mit eigenen Augen sah. Der Traum von einer intakten Natur, einer Symbiose von Mensch und Tier, taucht das Stillleben des Urwalds in ein unwirklich fahles Mondlicht, das den Himmel blass färbt und das Gras hell erleuchtet. Herausgehoben aus der Zeit, lässt es ein altes Gefühl vom Schöpfungsfrieden der Natur erklingen. Hier ist der Mensch nicht Herr und Gestalter. Er verwandelt die Natur nicht und beutet sie nicht aus. Stattdessen ist er ihr urwüchsiger Teil. Der Löffelreiher hat keine Angst vor der dunklen Eva, die eine Schlange beschwört, deren List kein Paradies zerstört. Wenn eine Gesellschaft der Jäger, Hirten und Kritiker der Zukunft nicht ihre letzte Ahnung von der Natur verliert, wenn sie mit der List ihrer Technologien die Natur nicht zerstört, sondern bewahrt, wenn die Technik ihr gar hilft, die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen zu verringern, und mehr Zeit dafür schafft, sie zu schützen — dann hätte sie dem Menschen ihren größten Dienst getan. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, ist nicht groß. Auch wenn mancher vor der Übermacht der Technogiganten des Silicon Valley in die Knie geht, wenn er dem Fatalismus Glauben schenkt, der Weg zur Diktatur der Maschinen sei evolu-tionär vorgezeichnet — den digitalen Umbruch ökonomisch und gesellschaftlich zu überleben und auf dieser Grundlage einen neuen Gesellschaftsvertrag zu finden können wir schaffen. Doch um welchen Preis? Dass unser Ressourcen- und Energieverbrauch die Erde im Eiltempo ruiniert, ist damit nicht
269
verhindert. In der Sahelzone wandert die Wüste täglich weiter nach Norden, der Aralsee und der Tschadsee sind nahezu verschwunden, die Pole schmelzen weiter, und der Regenwald stirbt dahin. Der Klimawandel, kaum gebremst durch die Industrieländer, macht schon bald viele Gegenden der Welt un-bewohnbar. Und dass es gelingt, hier umzudenken und für viele Milliarden Menschen auf unserem Planeten gute Lebensumstände zu schaffen, ohne gleichzeitig alle Natur, einschließlich unserer Atmosphäre, zu zerstören — dafür stehen die Chancen schlecht. Der Nährboden für den Pessimismus ist gut und reichhaltig gedüngt. Doch wenn alle Pessimisten sind, darf man sicher sein, dass tatsächlich am Ende die Dystopie steht, weil nie-mand sich auch nur bemüht, den Lauf der Welt zum Besseren zu wenden. Während der Optimist Mut braucht, kann es sich der Pessimist in seiner Feigheit bequem machen. Er benötigt nur genug von seinesgleichen, um sicher recht zu behalten.
Ein Optimist jedoch, dessen Erwartungen sich nicht erfüllen, hat allemal ein sinnvolleres Leben geführt als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht. Pessimismus ist keine Lösung!