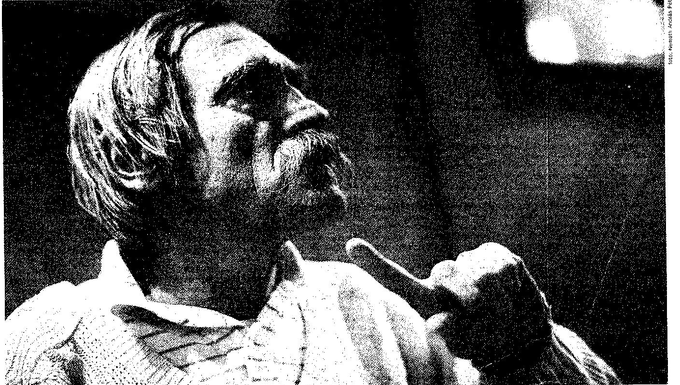FLASSBECK: EGY ÚJ NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI RENDSZER
370. oldal
Ahogy a fönnálló nemzetállamokon belül nemzeti csereszabályok vannak, ugyanúgy a globális cserére is kell lenni globális szabályoknak. Ezeket nem egyes államok állíthatják föl, hanem egy nemzetközi államközösség.
371
Ahogy a liberalizációnál az ipari államok sürgető és vezető szerepet vettek át,itt is az élen kell, hogy járjanak, ha arról van szó, hogy a pénzügyek és a valuta területén egy nemzetközileg elismert és keresztül vihető szabályrendszert kell kidolgozni. Egy új világvaluta-rendnek egyrészt a nagy blokkok közötti valutaviszonyokat kell szabályoznia, másrészt kisebb országoknak is meg kell adnia az esélyt, hogy valutáikat várható jó eredménnyel a nagy blokkokhoz kössék. Abszolút fix váltókurzusok vagy egy valutaúnió csak akkor állhatja meg a helyét, ha minden résztvevő nemzetnek belső költségvetését és inflációját sikerül határok között tartania, amit minden uniótag kész elfogadni. Hogy áru és tőke a világban szabadon mozoghasson, olyan régiók között is egy fenntartható valutarend kifejlesztése szükséges, amely régióknak – különböző okok miatt – költség- és infláció-konvergenciája gyorsan nem sikerülhet.
A források szétosztásában és a befektető döntésekben torzulások léphetnek föl, erős, az infláción fölüli váltóárfolyam ingadozásainak kiegyenlítése miatt. Egy valuta belső értékének, tehát vásárlóerejének ingadozása is ugyanúgy hátrányosan hat. Váltóárfolyam-változtatások csak inflációkülönbségek kiegyenlítésére kellene, hogy szolgáljanak. Ebből egy új világvaluta vezérfonala adódhat, eléggé stabil váltóárkurzusok esetében. Ennek alapján racionális gazdasági döntéseket lehet hozni. Ám egyidőben legyen annyi rugalmasság is, hogy minden állam nemzetközi versenyképessége megmaradjon. Egy ilyen ellenőrzött flexibilitás rendszere fölépítéséhez a nemzetközi együttműködést ezen a téren jelentősen erősíteni kell.
372
Ez először is a nagy ipari államok föladata. De ugyanúgy a nagy és kis népgazdaságok viszonyát is fejleszteni kell. A terjedő globalizáció, a világgazdaság egyre erősödő integrációja tükrében – a valutarendszertől függetlenül – a kis nemzetek egyre inkább képtelenek önálló gazdaságpolitikát folytatni. Ha áru- és tőkepiacaikat nyitva akarják tartani, váltóárfolyamaik szélsőséges kilengéseit elkerülendő, egy globális felügyelet és együttműködés alá kell vetniük magukat.
Egy új világvaluta-rendszerhez a nemzetközi közösségnek hatékonyan működő intézményekre van szüksége. Mindkét Bretton Wood-Intézet (a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank) a múlt évtizedekben feladatfelosztásukat és szerepüket a világgazdaság változó körülményeihez igazították. Mindkét intézet föladatait egy globális pénzügyi rendszernél újra meg kell fogalmazni.
Az IWF esetében ez annyit jelent, hogy föl kell idéznie eredeti szerepét a Bretton Wood-rendszerben. Ekkor újból át kell vennie a valutarendszer működési módjainak felügyeletét és a résztvevők makroökonómiai tanácsokkal való ellátását. Ezekhez tartozik pl. egy korai-előrejelző-rendszer fölépítése és kezelése, amely a súlyos gazdaságonkívüli egyenlőtlenségek keletkezésének veszélyeit fölismeri, az érintett országokat figyelmezteti és informálja a többi résztvevőt.
373
Ugyanúgy gyors intézkedések szervezése és kivitelezése financiálisan bajba jutott országok számára is az IWF föladata lenne.
Egy másik intézmány, pl. a Basel-i Nemzetközi Fizetéskiegyenlítési Bank (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) egy ilyen aktivitásnál szerepet kellene, hogy vállaljon, sokkal inkább, mint eddig, úgy, hogy az összpénzügyi szféra rendszerkockázatait elemzi és idejekorán ellenintézkedéseket javasol.
A globalizált piacoknál sem másképp, mint ahogy az nemzeti síkon magától értetődő, a kockázatok átvállalására szabályokat kell kidolgozni, információ-kötelezettséget, tehát hitelfelügyeletet kell bevezetni, a legszélesebb értelemben. Ehhez multilaterális egyezmények szükségeltetnek. A szabályzások ezen a téren azonban nem korlátozódhatnak az államegyezményekre. A privátszektor, tehát mindenki, aki a világátölelő pénzpiac esélyeit ki akarja használni, a kockázatok fedezésében jelentős mértékben részt kell, hogy vállaljon.
Gyakori az aggódás, hogy egy új világvaluta-rend és egy globális pénzügyi rendszer nemzeti szuverenitások elvesztéséhez vezethet. Ma a világkrízis azt mutatja, hogy ezektől az eseményektől való teljes lekapcsolódás, ilyen értelmű szuverenitás, nem fordulhat elő. A világ minden nemzete ilyen módon érintett. A II. világháború után a különböző valutarendszerek tapasztalatai világossá tették, hogy egy valutarendelkezés alkalmazása nem engedte meg az effektív leválást.
374
A nemzeti szuverenitás részleges elvesztése nem egy alkalmatlan valutarend következménye, hanem az áru- és tőkepiacok megnyitásának közvetlen eredménye. Ha effektív kereskedelem a cél, a váltóárfolyam-politikában való nemzetközi kooperációnak nincs alternatívája.
KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
A klíma és a környezetvédelem két nagy kihívás, melyek akkor is megmaradnak, ha a gazdasági problémákat javarészt sikerül megoldani. Ám itt is az emberiségnek sok gazdasági előítélet áll útjában. Teljesen mindegy, hogy a klímaváltozást, vagy a források túlhasználatát tartjuk döntő problémának, minden azon múlik, milyen viselkedés-változásokat akarunk elérni a piacgazdaság globális rendszerében.
Egy gazdasági dinamika realisztikus elmélete nélkül itt sem jutnánk előbbre. És pontosan ezen hiúsulnak meg a kísérletek, hogy az emberi élet természetes föltételeinek hatékony védelmét szavatolni lehessen.
Klímaváltozás és a piacgazdaság dinamikája
A környezet- és a klímavédelemnél az életföltételek mindenkori nemzeti állapota dönt, a politika konkrét választott útja révén. Itt is egy rendkívüli útfüggőség mutatható ki, melyből egy ország sem menekülhet.
375
Aki a múltban (mint pl. Svájc) áramfejlesztésre vízerőbe fektetett, teljesen másképp fog a klímával bánni, mint pl. No., ahol a barnaszén volt a legfontosabb fosszilis energiahordozó. A sok atomerőművel bíró Franciao. megint más feltételekből indul ki.
Mindazonáltal kétségtelen, hogy a klímaváltozás megfékezése vagy megakadályozása globális kihívás. Ezért a fenti különböző feltételektől függetlenül, csak akkor lehet a fosszilis energiahordozók csökkentésére hatékony stratégia, ha legalább a legfontosabb államok egy ilyen stratégiában megegyeznek.
Gazdasági szemszögből az ökológiai válságra adandó válaszhoz jelentős segítség adható, hisz itt a természetes források erőteljes fogyatkozása áll a központban.
Az elemzés klasszikus mikroökonómiával kezdődik. Első lépésben ui. az a kérdés, egy adott árupalettából az emberek mennyit hajlandók beáldozni, ha egészséges környezetért több forrást kell bevetni. Pl. fogyasztási cikkek gyártásakor keletkező károk szanálásánál, vagy, hogy a jövőben kevesebb káros anyagot kibocsájtó termelési módokat vezessenek be. Tehát költség-haszon kalkulációt kell fölállítani és hagyományos fogyasztási cikkekről lemondani, hogy környezeti károkat előzhessünk meg. (Tipikus növekedésrajongó közgazdász okoskodás, ahelyett, hogy kimondaná: ennek az esztelen, őrült fogyasztásnak, anyag- és személyszállításnak véget kell vetni! Aki vizet vesz a boltban; kitűnő, jól zárható, könnyű PET-palackot a szemétre dob, órákat autózik egyedül – az nem normális!RS).
Második lépésben meg kell néznünk, mit jelent ez összgazdasági szinten.
376
Környezetvédelem, mint preferencia
A legfontosabb és a közgazdászok által hevesen vitatott probléma abban áll, hogy a normális gazdasági szubjektum nem kap közvetlen hasznot abból, ha a termelésnél csökkenti a káros anyag-kibocsátást, mert nem lakik egy ilyen erőmű mellett. Ehhez jön, hogy nem tudja, hogy a többi gazdasági alany más régiókban vagy országokban ugyanígy megváltoztatja-e viselkedését és hogy a környezet-intézkedés szignifikánsan megemeli-e az összhatást? Másként: Ha egy bizonyos termék produkciójánál környezetkárok lépnek föl, nem lehet minden további nélkül azt hibáztatni, aki keresletével ezt a hatást okozta. Az összhatás semmilyen individuális költség-haszon kalkulációban nem merül föl. Ökonómia-nyelven szólva, extern hatásokat produkáltunk, melyek bár a társadalomnak ártanak, senki ezért személyesen felelősségre nem vonható. (Lásd vörös-iszap per, ahol mindenkit fölmentettek!RS).
Íme egy egyszerű példa: az autókban elégetett üzemanyag káros gázokat eredményez. Ezek az autó vezetőjét direkt nem károsítják, hanem azt, aki mögötte autózik. Tehát egy sofőrnek sincs érdekében autóját tisztábbá tenni, míg nem lehet biztos abban, hogy a többiek is ezt fogják tenni. Következésképp az államnak kell beavatkozni és mindnyájukat arra kényszeríteni, hogy tegyenek valamit a káros gázok ellen. A negatív externális hatást megakadályozandó az állam előírásokat hozhat, az autózást általában megdrágíthatja, vagy technikai normákat írhat elő a káros anyagok csökkentésére.
377
Azt is megpróbálhatja, hogy az externális hatásokat előírásokkal internalizálja, tehát az egyénnel érzékeltesse, anélkül, hogy más technikát írna elő. Pl. előírhatná, hogy a kipufogó gázokat először a kocsi belsejébe kell vezetni. Ez radikálisan hangzik, de vélhetőleg a leggyorsabb út. Véleményünk szerint, ha ezt az USÁ-ban 100 éve ezt bevezették volna, ma ugyanannyian vezetnének autót, mint most tesszük. Ekkor valószínűleg H2-autókat hajtanánk, mindenesetre az olaj egy nagy részét a földben hagytuk volna és kevesebb klímagázt produkálnánk. (1988-ban csináltunk egy hidrogén-konferenciát Kölnben. A H2 drága, előállítása rossz hatásfokú, részben ez is olajból jön. Még a földgázos autók sem terjedtek el, annyira körülményes és veszélyes ez a technika. Soha ilyen tömény és jól kezelhető energiahordozónk nem lesz, mint az olaj. Kár elégetni, amikor szerszámokat, gyógyszereket, élelmet lehet belőle csinálni.RS).
Ez a példa mutatja, hogy a mikroökonómiai kérdésföltevés zsákutcába vezet. Az a klasszikus döntéshelyzet, amelyből kiindul, a gyakorlatban nem is fordul elő. Az információk, melyek ahhoz szükségesek, hogy az emberek többségét döntés elé állítsuk, („Mit akartok? Több környezetvédelmet, vagy több árut?”) nem állnak rendelkezésre. Ez azzal kezdődik, hogy nincs egy adott „árupaletta”. Mindig dinamikus rendszerben mozgunk, ahol az emberi föltaláló szellem ezt az árupalettát folyamatosan bővíti, így szerkezete drámaian változik. Az emberek preferenciáikat sem ismerik, mert az újonnan föltalált termékek preferenciáit a jövőben fogják előállítani. (El tetszett szállni, Tanár úr? Minden föl van találva, ami most jön, az fölösleges vagy káros, 2004, RS).
378
Ehhez jön, hogy a technikai haladással a lehetőségek is, környezetvédelmet gyakorolni, folyamatosan változnak.
Senki sem tudja sok évre előre megmondani, hogyan alakul a választás a normál áruk és a zöld termékek között és hogy ez egyáltalán számít-e még? Vegyük ismét a H2-autók példáját. Ha egyszer már sikerült bevezetni, a következő 100 évre már teljesen irreleváns, milyen drága volt és mennyi normáltermék maradt fölhasználatlanul, vagyis az emberiség mennyi haszonkiesést kellett, hogy elszenvedjen, mert már korán a „drága” technikát választotta.
A gondolat, hogy környezetkárok rendszeresen a piacrendszerben lépnek föl, (externális hatások az emberek „normális” preferenciái nyomán) és ezeket az állam ilyen vagy olyan módon internalizálni kényszerül, akkor lesz teljesen életlen, ha a környezetvédelem az emberek preferenciái egy részévé válnak. Akkor tehát, ha az emberekben tudatosul, hogy a szükséges termékekkel a természetes környezet elhasználódik, és itt egy óriási fölzárkózó ill. megelőző igény lép föl, a már megesett károk helyrehozásának vagy új károk elkerülésének kívánsága, a normális preferenciákkal, mikrosíkon, versenybe fog kerülni.
379
Ekkor vállalkozókra lesz szükség, akik ezeket a preferenciákat fölvállalják és keresztül viszik. (És ki szanálja a szanálókat? Szemetet a 3. világba? RS). Mivel ezek a preferenciák nem föltétlen jobb termékek iránti keresletben nyilvánulnak meg, hanem inkább az absztrakt készségben, többet fizetni a környezetért, itt az államnak kell beavatkozni. Kényszeríheti a vállalkozókat bizonyos óvintézkedésekre (pl. katalizátorokra, szűrőkre vagy más technikák beépítésére az autókba) ezzel a polgár jobb levegő-igényét teljesíti, egyidőben ennek költsége viselésére is. Ám a kényszer csak abból a tényből ered, hogy különben sokan potyautaskodnának, mondván, „mások” már eleget tettek, ők ezért már nem kell, hogy fizessenek.Teljesen másképp, ahogy azt velünk a piac-apologéták elhitetni próbálják, miszerint az állami kényszer az, amikor az állam az emberekre valamit ráerőszakol, amit azok egyáltalán nem akarnak. Az állam, mint egy vállalat, meggyőzi a polgárokat, vegyék meg termékeit. A kényszer nem jelenti a priori, hogy ez a piacnak teljesen idegen.
De ha ez így is lenne, hogy az állam csupán jobb belátásból cselekszik és a polgárokra valamit ráeröltet („meritorikus” termékeket teremt, mondták régen) ami egy demokratikusan választott államvezetés fölmérése szerint jólétüket szolgálja és a piacnak idegen – mint közgazdász, nem mondhatom egyszerűen, ez a valami a piacnak idegen, ezt le kell, hogy, úgymond, vonjam a jólétből.
380
Az persze, hogy az állam a gyereket iskolába küldi és nem szabad dolgozniuk, egyesek érezhetik ugyan kényszernek, mégis a polgárok túlnyomó része ezt ma magától értetődőnek tartja. (Kellett is hozzá 200 év!RS). Tudják, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a társadalom hosszú távon anyagilag és szellemileg gazdagodjon. Ha ezen az alapon a környezet- és klímavédelmet a polgárok és a társadalom igényeihez és preferenciáihoz soroljuk, egy egész problémaköteg oldódik meg, amely az uralkodó gazdasággal és a környezetvédelemmel, különösen az ún. „környezetvédelmi költségekkel” kapcsolatos.
Költségek és munkahelyek
Mik ezek a híres költségek, melyeket a gazdaság emleget, ha a környezetvédelemről van szó? Ha pl. a VW ugyanúgy, mint az összes többi, az emisszióértékek betartására egy technikát építene be, hol lenne itt a probléma? A többletköltségek a fogyasztókra hárulnának, ha ezáltal a jármű drágább lenne, és ezek a költségek megnövelt termelést jelentenének a technika beszállítóinak. A vásárlók többet fizetnének az autóért, de ezt – adott jövedelemnél – más fogyasztásból vennék el. Az autógyárak lemondhatnának valamilyen díszítő elem beépítéséről és így a magasabb környezetköltségeket kiegyenlítenék.
Összgazdaságilag nézve az eredmény mindig ugyanaz: jövedelem-többletek keletkeznének, és munkahelyek a beszállítóknál, ahol a megtakarítás történik, ott kevesebbet keresnének (munkahelyeket számolnának föl), pl. a díszítő elemeknél. Ez nem probléma, csupán teljesen normális impulzusok a szerkezetváltás irányába, melyek naponta privát diszpozíciók nyomán megesnek. A politika ezzel nem kell, hogy foglalkozzon.
Ha azonban a politika egy autógyár egy beszállító ágát terheli meg, csapdába kerül, mert be kell, hogy vallja, hogy egy szakág vagy egy termelő pozícióját gyengíti azáltal, hogy állami előírásokkal a gyártást megdrágítja. Ekkor a politika nehezen fogja kimenteni magát a munkahelyeket veszítő termelőknél, azzal, hogy a környezetvédelem fontosabb, mint a munkahely. Így kezdődik egy huza-vona, amibe egy kompetens állam (tehát amelyik kizárólag összgazdaságilag gondolkodik) egyáltalán nem kéne, hogy belemenjen.
382
Itt egy pillantással látható, miért megy félre egy szakág síkján a környezetvédelem-munkahely-vita. A mindenapi szerkezetváltozásnál, melyet a privát termelők ránk tolnak, (pl. reklámmal) sosem kérdezzük, ezek vajon kedvezőek-e a munkahelyekre és a jövőre? Ha egy tablet egy deszktopot kiszorít, a munkahelyek és kereseti lehetőségek eltolódnak. Senkinek sem jut eszébe ezeket a fejleményeket elvágni vagy gyöngíteni, a munkahelyek érdekében. Csak amikor az állam van belekeveredve, protestál minden egyes termelő (főleg a nagyok). Ez a konfúzió természetesen nem volna lehetséges, ha a népgazdászok valóban népgazdaságot csinálnának és nem álcázott üzemgazdaságot. Itt az ökonómiai konfúzió egy igen szomorú fejezetét kell megnyitnunk. Az uralkodó gazdaság ui. már a 70-es években a varázslatos négyszögből, tehát a makroökonómiai célokból (árstabilitás, külgazdasági egyensúly, magas foglalkoztatottság, megfelelő növekedés) sikerült egy ötszöget formálni, amikor a környezetvédelmet is beemelte egy külön sarokba (Flassbeck és Meier-Rigaud 1982).
Ez egy óriási melléfogás volt, ma is az, mert az emberek a tiszta környezet iránti kívánsága (vagy az általuk értelmezett környezetvédelmi szükségesség) a mikrogazdasági preferenciák közé tartozik és a rendszer makrogazdasági vezérléséhez semmi köze, sem ahhoz, ezzel milyen eredmények érhetők el.
383
A környezetvédelem preferenciákba való besorolása mutatja, a zöld mozgalom eufóriája a „két osztalékról” (környezetjavítás és munkahelyek) ugyanannyira félrevezető, mint a fent vázolt konfliktus. A környezetvédelem ebben a fölfogásban egy teljesen normális termék, (az egészség, az iskolás gyerek is?RS), melyeknek gyártását egyszerűen az államnak kell beindítani. Ilyen értelemben több környezetvédelem gyártása nincs konfliktusban a munkahelyekkel és túl sok munkahelyet sem lehet tőle elvárni. Ezt egy megfelelő gazdaságpolitika tudomásul veszi és föladatát teljesen függetlenül attól látja el, mennyi környezetvédelmet valósít meg más területeken az állami politika. Egyetlen terület, amelyen a fölvilágosult közgazdászok gyakran úgy hiszik, ezt a logikát korlátozhatják, a nemzetközi versenyképesség. Valóban, ha egy állam szigorú környezetvédelmi föltételeket szab, kereskedelmi partnere viszont nem, akkor egyszeri költséglejtő keletkezik, mely azt az államot kedvezményezi, amelyik a környezetért semmit sem tesz.
Itt a környezetvédelem normálpreferenciák közé való besorolása sem segít, mert minden további nélkül az lehet, hogy az emberek kívánalmai (vagy a természetes föltételek) a másik országban olyanok, hogy az állam ott kissé jogosan kevesebb környezetvédelmet valósít meg.
384
Más szavakkal: ezen két állam viszonyában nem lehet egyszerűen föltenni, hogy a termelés a környezetvédelemben annyira keresett, mint egy nomáltermék iránt, mivel környezetpreferenciák csak az egyik államban vannak. Következésképp a költségek is (itt is, ha minden más egyenlő) és a normáláruk árszinje (és vélhetőleg minden más) abban az országban, a magas kirovások miatt, magasabbak.
Egy egyszeri költséglejtőt, ha ez tényleg jelentős, az állam sokféleképp egyenlíthet ki. A kevésbé szigorított termeléseknél az árukra állandó vámot vethet ki, saját vállalatainak adókedvezményeket adhat, vagy szubvenciót. Mindeközben nem szabad elfelejteni, hogy sok államban az abszolút költségszint durván torzított, köszönve az állami beavatkozásoknak. Az adókulcsok magában az EU-n belül is nagyban eltérnek, anélkül, hogy ezek mögött szisztematikus versenytorzítást sejtenők. A különböző adóterhekkel szemben az állam általi különböző infrastruktúrák kiépítése áll. Magas adójú államokban ez szubvenciónak számít. Ehhez az infrastruktúrához tartozik a munkaerők jobb kiképzése is.
Árakkal való irányítás – hogyan is másképp?
A véges nyersanyagforrások miatt nyilvánvaló, hogy a környezet is egy szűkösségi kérdés és ezzel árkalkulációt is von maga után. Rá kell bírni az embereket az egész Földön, hogy a természeti kincsek egyszeriek és ezekkel csínján kell bánnunk. E mellett, az árkialakítással közvetlenül ösztönözhetők az emberek, hogy intelligenciájukkal és kreativitásukkal, messze a mai technikákon fölül, módot találjanak a fosszilis energiahordozók megtakarítására. Ha egy ilyen globális árdrágítást érnénk el, folyamatosan olaj- és szén-áremelkedést - jövedelmünkhöz viszonyítva - akkor számolhatnánk jelentősebb erőfeszítésekre az energiamegtakarításban, nagyobbra, mint amit az államok előírásokkal elérnének. A megújuló energiák egy nagy része azért nem kerül hasznosításra, mert a fosszilisok, 40 éve az első olajárkrízis után is, olyan olcsók, mint akkor.
Ennek első ellenérve sokak szerint „hát ez sokba kerül”. Természetesen, különben honnan származna egy ilyen óriási befektetés? Ez összgazdaságilag mégsem probléma, mert ebből megint sok termelő profitál, míg mások visszalépnek. Az ezzel járó szerkezetváltás szándékos, de mindig valamibe kerül, csak most az ügyfelek mást vásárolnak. Sok régi termelő veszít, de sok új nyer. Hogy ennek a nagy energiakonszernek nem örülnek, világos, de mért zavarja ez a politikusokat? (Mert ők ez energiacégek lobbyistái!RS)
Aki a fosszilis- és atomenergiából ki akar szállni, meg kell, hogy ezeket drágítsa. Így a megújulók versenyképesek lehetnek, vagy ezeket direkt szubvencionálni kell. Be lehet vetni az ún. új piacgazdasági eszközöket és azokat terhelni, akik a káros anyagokat kibocsájtják. Ez történhet tanúsítmány vásárlási kényszerrel. Ha ezután a tanúsítványok számát konzekvensen és folyamatosan lecsökkentjük, úgy, hogy az áruk állandóan nőjjön, a viszonylagos ár ugyanúgy a megújulók javára változik. Mivel a politika az energiaárakhoz eddig globálisan nem mert hozzányúlni és az új piacgazdasági eszközökkel sem élt, No.-ban az utóbbi 10 évben a szubvenciót választották.
A szövetségi kormány a fosszilis energiahordozók vonzerejét csökkentette, (relatív árukat megnövelte) úgy, hogy a megújulók építését szavatolt átvételi árral szubvencionálta. Ez teljesen jogos, hisz ilyen szubvenciók nélkül nincs Energiewende (energiaváltás). Nem úgy látszott, hogy a piac önszántából az olajárakat fölvinné, hogy ez az energiaváltás magától jőjjön.
386
Mellékesen, ilyen szubvenciókat kap az atomipar is, amikor az átmeneti atomhulladék-tárolókra és kártalanításokra pénzeket adnak (ami nincs benne az áram árában; Asse, Gorleben, stb.). Ezen időbombák hatástalanításának költségei az adófizetőkre hárulnak, nagy konszernek ezek alól eddig sikeresen kibújtak.
No. a relatív ár változtatásával mindenesetre egy energiaváltást ütött nyélbe. Gyorsabban, semmint bárki gondolta volna, az áramfejlesztésben átállás történt a fosszilisekről a megújulókra. Ez a példa mutatja, itt nagyban segít a vállalkozások flexibilitása, bár a folyamatnak semmi köze a piacgazdasághoz. Az állami garancia a fix átvevő árakra a befektetéseket kiszámíthatóvá tette. Szinte mindenki, akinek fölösleges pénze volt, szolár berendezésekhez keresett alkalmas tetőt vagy helyet szélgépnek. Így váltak egyszerre a gazdák, ház- és étteremtulajdonosok áramtermelőkké.
388
Elosztás-kihatásokat kiegyenlíteni
Ezzel megmutatkozott, milyen rugalmasok tudnak lenni a vállalkozások. Még olyan óriási kihívással is megbírkóznának, mint a klímaváltozás. El kell kezdenünk fölfogni, hogyan működik a piacgazdaság és nem szabad térdre esnünk egyes nagy „játékosok” lobbyhatalma előtt, sem visszariadni ideológiai akadályok előtt („az államnak tilos tartósan az árképzésbe beavatkozni”). A német példa mutatja egy ár hatását egy támogatandó termékre, mely elegendő időre elegendően stabil marad. Vannak további pénzelési föltételek, melyekkel olyan emberek is befektetnek a környezetbe és a jövőbe, akiket eddig a környezet és a jövő generációk hidegen hagytak. Ez csakis az állammal és az államokkal megy. Aki közérdekű termékeknél klímaváltozásnál a piacra vár, örökké várhat. (Szeplőtelen fogantatás! Nincsenek környezetbarát termékek, sem zöld kapitalizmus. A probléma a mennyiség. A fogyasztást le kell vinni az ötödére, l. Wuppertal-Inst.RS).”De a szegény áramfogyasztók és különösen a szegények” nyögtek No.-ban olyanok, akiket eddig a szegények és a jövedelmek nem érdekeltek. Nem tagadhatjuk, hogy az ilyen piacgazdasági eszközök az alacsonyabb jövedelműeket jobban megterhelik, mint a jólkeresőket. Ez főleg akkor érvényes, ha számításba vesszük, hogy az utóbbiak jóval több energiát fogyasztanak. A kérdés: Mit is akarunk?
389
Sok más példából tudjuk: az alanyi támogatás hatékonyabb, mint a tárgyi. Tehát a kevésbé tehetőseket jobb direkt anyagilag támogatni, mint az árképzést elhagyni. Ha a politika ezt teszi, a rendszernek nem kell lemondania sokak föltaláló szelleme serkentéséről, mely csak az árirányítással lehetséges. Kitartani az mellett, hogy a szegényebbeket kevésbé terheljük, biztosan helyes. Ez a szegény országokra is vonatkozik. Ezeket pénzügyileg olyan helyzetbe kell hozni, hogy az emelkedő energiaárakat ki tudják fizetni. Minden Hartz IV-szoc-segélyezett maga dönthesse el, hogy magasabbb transzferjövedelmét magasabb fűtésköltségekre adja ki, vagy energiatakarékosságot választ és a többlet pénzt más fogyasztási cikkekre költi el. A Hartz IV-et jól meg kell emelni, a kiskeresetűek adóját csökkenteni, emelkedő és országos minimálbéreket bevezetni vagy a kiskeresetűek szociális járulékaikat szisztematikusan levinni – ha valóban energiapolitikai fordulatot akarunk elérni. Aki ezt elveti, hiteltelenné válik. Még akik úgy hiszik, Hartz IV-gyel munkösztönzést lehet elérni – meglehetősen az átlagbér alatt – így a munkanélküliséget csökkenteni, azok is be kell, hogy lássák, az alacsonyjövedelműek életszínvonalát tovább rontani nem jogos. Természetesen a politikának készen kell lenni arra, hogy az érintettek újabb terhelését kompenzálják, elkerülve mindkét csapdát.