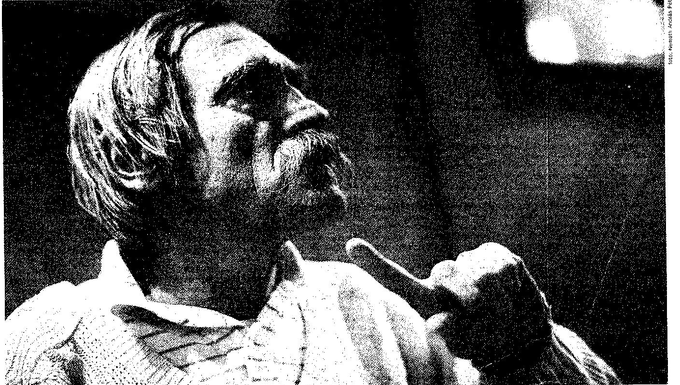den H lz- und Kupferstichen kursieren massenhaft unter den Leuten
wie eiligenbildchen. Mit dem Erfolg, dass Luther bald auch wie ein
Heiliger verehrt wird. Heute würde man sagen: wie ein Popstar.
Diesem Zweck dienen auch die Doppelbildnisse von Katharina
und Martin Luther, die in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren
entstehen, gleich bei ihrer Skandalhochzeit 1525 fängt Cranach mit
dem Porträtieren an und malt das so ungewöhnliche wie provokante
142 Paar aus Ex-Mönch und Ex-Nonne systematisch hof- und gesell-
schaftsfähig: Wer so bürgerlich-stolz repräsentiert, dem können die
bösen Nachreden nicht mehr allzu viel anhaben, den muss man ernst
nehmen. So ernst, wie Luther die Ehe nimmt und als gottgewollt ge-
gen den Zölibat verteidigt.
Dank Luther, Cranach und einigen anderen Zeitgenossen wissen
wir Etliches über die Zeit Katharinas an der Seite ihres Mannes, dafür
aber fast nichts über die Zeit davor. Halten wir uns also an das wenige,
das verbürgt ist: Katharina wird 1499 geboren, am 29. Januar, auf ei-
nem Gut in der Nähe von Leipzig, wo genau lässt sich nicht sagen, weil
die adeligen Sippen beider Eltern weitverbreitet sind im sächsischen
Raum. Ihr Vater ist Hans von Bora, ihre Mutter eine geborene von
Haubitz oder Haugwitz. Sie stirbt, als Katharina erst fünf Jahre alt ist.
Damit ist ihre Zeit im Elternhaus vorbei. Der Vater gibt die Kleine
als ››K0stkind« zu den Benediktinerinnen nach Brehna. Das ist zwar
sehr früh, aber nicht unüblich. Die Klöster sind voll von Töchtern aus
verarmten adeligen Häusern, die es sich nicht leisten können oder
wollen, alle Kinder selbst großzuziehen, auszubilden und sich spä-
ter um deren Verheiratung zu kümmern und eine ordentliche Mitgift
aufzubringen.
Für die Frauen ist das nicht einmal das Schlechteste, denn mag
das Leben im Kloster auch karg und nach rigiden Regeln geordnet
sein, so eröffnet es ihnen doch auch Chancen, die anderen Frauen
ihrer Zeit vorenthalten bleiben. Nonnen lernen nicht nur Rechnen,
Lesen und Schreiben, sondern arbeiten auch in den Klostergärten,
sind in der Kräuterkunde bewandert und wissen, welches Kraut ge-
gen Kopfweh und' welches bei Magenverstimmung hilft. Vor allem
aber verfügen sie über gerade so viel Latein, dass sie am geistigen
Leben ihrer Zeit teilnehmen können.
Ein Jahr nach dem Tod von Katharinas Mutter heiratet der Vater
Hans von Bora wieder. Für Katharinas weiteres Leben spielt es keine
Rolle mehr. Ihre drei Brüder übernehmen die beiden F amiliengüter,
können sie aber nicht halten, denn die Familie verarmt zusehends.
Eine Erfahrung, die sich Katharina tief einprägt: Sie wird in der Ehe
mit Luther diejenige sein, die das Geld nicht nur durch kluges Wirt-
schaften zusammenhält, sondern auch selbst für ein Familienein-
kommen sorgt, indem sie später im Schwarzen Kloster zu Wittenberg
Zimmer an Studenten vermietet. Außerdem kauft sie, gegen Luthers
Willen, ständig Land hinzu, um Gemüse und Obst für den immen-
sen Bedarf der großen Hausgemeinschaft anzubauen. Und wohl in
Gedanken an eine mögliche Zukunft nach Luthers Tod wird sie - um
wirtschaftlich' unabhängiger zu sein - später sogar die beiden verlo-
renen Landgüter ihrer Eltern in Zülsdorf und Wachsdorf wieder zu-
rückkaufen.
Mit neun oder zehn Jahren wechselt Katharina in das Zisterzien-
serinnenkloster Marienthron in Nimbschen, wo eine Verwandte ih-
rer verstorbenen Mutter als Äbtissin dient. Auch eine Schwester ihres
Vaters, die geliebte Muhme Lene, lebt dort, das wird es ihr leichter
machen, sich an die fremde neue Umgebung zu gewöhnen. In Nimb-
schen aber ist sie kein Kostkind mehr, sondern wird für den geistli-
chen Stand ausgebildet: Katharina soll Nonne werden. Sie liest und
schreibt und singt schon die liturgischen Gebete auf Latein, kennt
sich aus mit allen Heiligen, sie stickt und gärtnert. Aus den Annalen
des Klosters geht hervor, dass sie in Marienthron zusammen mit acht
anderen adeligen Klosterschülerinnen aus der näheren Umgebung
lebt, alle entstammen dem sächsischen Adel.
Auf diese Herkunft seiner Frau wird Martin Luther später so stolz
sein, dass er sie nicht nur Katharina Luther nennt, sondern fast im-
merl auch bei ihrem Geburtsnamen Katharina von Bora. Wie sehr
er sjeine kluge und durchsetzungsstarke Frau aber tatsächlich res-
pekliert, erkennt man auch an der witzigen und liebevollen Anrede
»I-Iirr Käthe« _ so nennt er Katharina, oder »Dominus Ketha«. In sei-
nen Briefen, zum Beispiel am 4. Oktober 1529, schreibt er sie so an:
›`›Meinem freundlichen, lieben Herrn Katharina Lutherin, Doktorin,
Predigerin zu Wittenberg. Gnad und Friede in Christo! Lieber Herr
Käthel« Ein andermal, am 16. Juli 1540, beginnt er, auf ihren Kauf
144 von Gut Zülsdorf anspielend, so: »Meiner gnädigen Jungfer Katherin
Lutherin von Bora und Zülsdorf zu Wittenberg, meinem Liebchen«
und den nächsten Brief, zehn Tage später, widmet er ››Der reichen
Frau zu Zülsdorf, Frau Doktorin Katherin Lutherin, zu Wittenberg
leiblich wohnhaft und zu Zülsdorf geistlich wandelnd, meinem Lieb-
chen, zu Händen.<<51
Was lässt sich nicht allein aus dieser Anrede herauslesen: Liebe-
voll und ein bisschen ironisch geht er mit ihr um, vor allem was ihren
Geschäftssinn als ››reiche<< Besitzerin eines eigenen Gutes außerhalb
von Wittenberg angeht; die Anerkennung ihrer Klugheit steckt in der
››Doktorin«, und nicht zuletzt das ››Liebchen« zeigt, wie zärtlich sich
dieser oft auch grobe Mann seiner Katharina gegenüber ausdrücken
kann. Es wird ihr gefallen, so originell adressiert zu werden!
Aber noch ist sie im Kloster, bereitet sich 15-jährig auf ihr Novizi-
at vor, die einjährige Ausbildung und Vorbereitung auf die Heirat mit
Jesus Christus, wie man den endgültigen Klostereintritt von Frauen
auch nennt. Es ist der frühestmögliche Zeitpunkt, Nonne zu werden.
Nutzt Katharina die Jahresfrist, die ihr zur Selbstprüfung gegeben ist,
ob der eingeschlagene Weg der richtige ist- wir wissen es nicht. Von
Zweifeln ist jedenfalls nichts überliefert. Und wie sollte sie sich auch
prüfen - sie kennt ja nichts anderes als das Klosterleben, kann sich
ein anderes Leben zu diesem Zeitpunkt sicher kaum vorstellen. Als
Alternative käme nur eine standesgemäße Heirat in Betracht, die aber
scheidet für eine so mittellose Nonne, wie sie es ist, aus. ~
Und so legt Katharina am 8. Oktober 1515 die drei Gelübde Armut,
Keuschheit und Gehorsam ab und gehört nun zum geistlichen Stand
der Nonnen. Ab jetzt trägt sie die weiße Kutte der Zisterzienserinnen
und den schwarzen Schleier über dem nun kurz geschorenen Haar.
Sie isst nur zwei Mal am Tag, fastet an zwei Tagen der Woche, singt und
betet in den Gottesdiensten mehrmals am Tag, von früh vor Sonnen-
aufgang bis nach Mitternacht. Miteinander zu sprechen ist den Non-
nen in der Kirche, im Esssaal und in den Schlafzellen verboten, lautes
Lachen erst recht. So sind die Regeln, alle Nonnen leben danach.
Aber bei der Arbeit können sie sich austauschen, von Ausflügen
in die Umgebung wird berichtet und von Besuchern, die ins Kloster
kommen. Katharina und ihre Mitschwestern leben jedenfalls nicht
so abgeschieden, dass sie nicht mitbekämen, was sich »draußen im
Land« so tut.
Acht Jahre wird sich Katharina an ihre Gelübde gebunden
len, danach bricht sie konsequent und dauerhaft mit allen dreien. Mit
dem Gehorsam zuerst, und ihr weiteres Leben bestätigt sie in der
Erfahrung, dass sie gut damit fährt, ihren eigenen Kopf einzusetzen.
Den Ungehorsam wird sie beibehalten, auch als spätere Ehefrau, zum
Leidwesen Martin Luthers: »Wenn ich noch mal freien sollte, wollt
ich mir ein gehorsam Weib aus einem Stein hauen, denn ich bin ver-
zweifelt an aller Weiber Gehorsam<<52, klagt er einmal, abet' Sehr emst
klingt es nicht.
Nein, ein gehorsames Weib ist Katharina sicher nicht, sonst näh-
me ihr Leben jetzt nicht den abenteuerlichen Verlauf, der nun be-
ginnt. Ein gehorsames Weib - und erst recht eine Nonne - lässt sich
nicht von irgendwelchen Revoluzzerideen infizieren und entschließt
sich dann auch noch davonzulaufen, in ein ihr völlig unbekanntes
Schicksal jenseits der Klostermauern. Diese Flucht macht sie be-
rühmt, und als entlaufene Nonne, die den gleichfalls entlaufenen
Mönch Martin Luther heiratet, wird sie in die Geschichte eingehen.
Wie aber kam es zu diesem Entschluss? Was hat die acht anderen
Nonnen von Marienthron bewogen, von heute auf morgen mit ihrer
Vergangenheit zu brechen, den sicheren, Schutz bietenden Kloster-
käfig zu verlassen und sich auf so ein Abenteuer mit ungewissem Aus-
gang einzulassen?
Wiederum kennen wir darauf keine Antwort. Keine der Nonnen
hat die Geschichte ihrer Flucht und dem, was ihr vorausging, aufge-
schrieben, zumindest wissen wir davon nichts. Dabei ist kaum vor-
stellbar, dass sie von so einschneidenden Erlebnissen nicht erzählen,
sie nicht in Briefen an die Verwandten schildern -wenn nicht als gro-
146
160 ßes Abenteuer, so doch vielleicht, um sich vor der Familie zu recht-
fertigen. Denn die Anfeindungen sind enorm, die Gesellschaft ist ge-
spalten in Anhänger und Gegner der Reformation und der Riss geht
sogar quer durch die Sippen.
Wir wissen also nicht, was in den Köpfen der Nonnen aus Nimb-
schen wirklich vor sich geht. Wir wissen nur: Luthers gefährliche Ge-
danken haben auch dicke Klostermauern durchdrungen und Mönche
und Nonnen angesteckt. Vermutlich war es brandgefährlich, Luthers
Schriften heimlich zu lesen oder gar zu diskutieren. Aber auf viele
wirkten die Luther-Worte so überzeugend, dass sie jede Gefahr in Kauf
nahmen und ihr Leben radikal änderten. Immer mehr Mönche und
Nonnen verließen ihre Klöster, und eine davon war Katharina, der
Luther zur Flucht verholfen hat, und die ihm nun sagt: Heirate mich.
Und der mag sich gedacht haben: Ob ich mit dieser eigenwilligen
Person glücklich werde, weiß ich nicht, aber wer so für die Ehe trom-
melt wie ich, sollte der nicht selbst mit gutem Beispiel vorangehen?
Theoretisch war Luther schon lange für die Ehe, lobt sie gerade-
zu als ››Gottesdienst«, zumindest als einen gottgewollten Dienst, den
Ehepartner einander erweisen. Denn hat Gott nicht Mann und Frau
erschaffen, damit sie fruchtbar seien und sich mehrten? Und ist Gott
nicht »eine Magd, die ein Kind wickelt und ihm einen Brei kocht und -
selbst wenn es das Kind einer Hure wäre - lieber als alle Mönche und
Nonnen dieser Erde, die sich nicht auf Gott berufen können?« 53
Nur die Lust, die mit dem fruchtbar sein zwangsläufig verbunden
ist- die macht den Kirchenleuten zu schaffen; für sie ist das kein Ge-
schenk Gottes, sondern ein Fluch der Menschheit, seit ihrer Vertrei-
bung aus dem Paradies. Daher halten sie die Fleischeslust nicht allein
für sündig, sondern ~ weil unkontrollierbar - auch noch für hoch
gefährlich. Vor allem bei den Weibern, deren Lust mit dem Teufel im
Bunde scheint, unersättlich wie sie sind.
Auch Luther hadert noch mit der Lust, er ist ja doch auch ein
Mann der Kirche und Kind seiner Zeit. Aber es gibt sie nun mal, die
Lust, man kann sie nicht wegdiskutieren, auch die Frömmšten schaf-
fen das nicht. Also muss man sie in geordnete Bahnen lenken, die Ehe
ist wie geschaffen dafür. ›>Die Begierde kommt ohne besonderen An-
lass, wie Flöhe oder Läuse; Liebe aber ist dann da, wenn wir anderen
dienen wollen« 54, erklärt er sein Ehe- oder Liebesverständnis. In der
Ehe kann die Lust ausgelebt werden, um der Kinder willen, die sich -
in möglichst großer Zahl - einstellen sollen. Das zähmt die gefähr-
lichen Triebe und macht sie produktiv. Bedingung ist allerdings die
Treue - der Pfeiler, auf dem Ehe hauptsächlich ruht. Einander dienen
und sich treu sein, sind die Voraussetzungen für eine gute Ehe.
Die positiven Erfahrungen, die Luther in der Ehe macht, werden
seine Einstellung zur sündigen Sexualität jedoch ändern, und er wird
zu der Überzeugung gelangen, dass Gott ›>Lust, Liebe und Freude« 55
gefallen.
Ein weiterer Grund, der Martin Luther nun für die Ehe erwärmt,
sind seine Eltern, denen er damit eine Liebe tun kann. Denn die wa-
ren nie glücklich über seinen Entschluss, ins Kloster zu gehen, hätten
ihren Sohn gerne eine juristische Laufbahn einschlagen sehen und
Enkelkinder gehabt. Jetzt bietet sich eine Chance zur Aussöhnung.
Und dann kann es Martin Luther nicht schnell genug gehen: Verlo-
bung und I-lochzeit werden gleich zusammengelegt, auf den 13. Juni
- Da sind außer den alten Luders, seinen Eltern - von Katha-
rinas Familie ist offenbar nur die Tante Lene anwesend - die engs-
ten Freunde aus Wittenberg dabei. Katharina wird von den Cranachs
zu Luther ins Schwarze Kloster geführt, und was nach der Segnung
durch Pastor Bugenhagen passiert, schildert der Freund Justus Jonas
so: »Luther hat Katharina von Bora zur Frau genommen. Gestern war
ich zugegen und sah das Paar auf dem Brautlager liegen. Ich konnte
mich nicht enthalten, bei diesem Schauspiel Tränen zu vergießen.«56
Was bedeutet das? Haben Martin und Katharina etwa ›>das Bei-
lager unter Zeugen abgehalten<<, wie es in historischen Berichten
heißt, also die Ehe - ihr erstes Mal - coram publico vollzogen, um die
Jungfräμlichkeit der Braut unter Beweis zu stellen? Denn böse Zun-
gen haben ja das Gerücht gestreut, dass sie längst in Unzucht lebten, der abtrünnige Mönch und die entlaufene Nonne, und dass die Braut
schon schwanger sei und deshalb so schnell geheiratet werden müsse.
Nichts davon stimmt, und im Juni 1525 ist das Beilager auch nur
noch ein Ritus, der an die alte Sitte der öffentlich vollzogenen Ehe
erinnert: Martin Luther und Katharina von Bora legen sich nur noch
symbolisch auf ihr Brautlager, in den Kleidern, die eigentliche Hoch-
zeitsnacht findet später ohne Zuschauer statt.
Philipp Melanchthon, der engste Mitarbeiter Martin Luthers, ist
erst zur vierzehn Tage späteren großen Feier, der sogenannten Wirt-
schaft eingeladen, dem Fest für den großen Kreis der Freunde und
Verwandten, unter ihnen als Ehrengast auch Leonhard Koppe, der
Nonnenräuber und Befreier Katharinas. Melanchthon aber kränkt es
sehr, nicht im engsten Kreis mitfeiern zu dürfen, der Brief an einen
Freund verrät, wie sehr ihm das zu schaffen macht: »Unerwarteter-p
weise hat Luther die Bora geheiratet, ohne auch nur einen seiner
Freunde vorher über seine Absichtzu unterrichten Du wunderst
dich wohl, dass in so ernsten Zeiten, da die Guten überall so schwer
leiden, dieser nicht mit den anderen leidet, sondern vielmehr
schwelgt und seinen guten Ruf kompromittiert Der Mann ist über-
aus leicht zu verführen, und so haben ihn die Nonnen, die ihm auf
alle Weise nachstellten, umgarnt, obgleich er ein edler und wackerer
Mann ist.<< Möge ››der Ehestand ihn würdevoller<< machen, auf dass er
seine tadelnswerte ››Possenreißerei« 57 verliere, schließt er.
So also urteilt der Mann, der als Luthers wichtigste Stütze im
Kampf um die Reformation gilt. Ganz klassisch sieht er Martin als
Opfer eines verführerischen Weibes, wie es ja schon der Sündenfall
im Paradies lehrt. Wenn so schon Freunde urteilen - wie schlachten
dann erst Luthers Feinde die Hochzeit aus! Da nennt man Luther ei-
nen ››Nonnenhengst<<, halt- und maßlos seinen fleischlichen Begier-
den ausgeliefert, und Katharina von Bora eine ››treulose, meineidige,
entlaufene Hure« 58.
Ob die meist anonymen Schmähschriften die beiden sehr verlet-
zen? Oder können sie den Dreck, der nun kübelweise im Land über sie ausgeschüttet wird, tatsächlich ignorieren, wie Luther behauptet -
149 wir wissen es nicht. Leicht ist es sicher für beide nicht. Doch kommt
das erste Kind -Johannes - ganz ordentlich erst nach einem Jahr zur
Welt und trägt auch keine zwei Köpfe auf den kleinen Schultern, wie
zuvor geraunt worden ist, weil es heißt, dass Mönche und Nonnen
miteinander nur Monster hervorbrächten. Nein, es ist ein gesunder
kleiner Junge; er stopft den Abergläubischen das Maul und straft die
Verleumder Lügen.
Üppig ist das Eheleben im Schwarzen Kloster nicht, wo Martin
Luther nach seinem Austritt aus dem Augustinerorden drei Jahre zu-
vor einfach weiter wohnen bleibt, jetzt mit seiner Frau Katharina.
Alle anderen Mönche sind längst in alle Winde zerstreut. Als Abfin-
dung für die Klosterzeit bekommt Martin Luther etwas Geld und darf
Mobiliar behalten. Aber das ist alt und schäbig und sein Gehalt als
Prediger an der Stadtkirche knapp.
Aber Katharina von Bora hat das Wirtschaften in Nimbschen ge-
lernt, oder ist sie vielleicht eine ökonomische Naturbegabung? Je-
denfalls übernimmt sie die Geschäfte in dieser Ehe. Das zeigt sich
erstmals beim Hochzeitsgeschenk des Kardinals Albrecht von Bran-
denburg (und Mainz), der ein Gegner der Reformation ist, weil er
nicht auf das Geld aus dem Ablasshandel verzichten will. Immerhin
sendet er aber eine Silberdose mit 20 Gulden. Doch Luther ist em-
pört und weist die Gabe zurück. Doch hat er nicht mit seiner Frau
gerechnet, die den Boten an der Hintertreppe abfängt und Gulden wie
Silberdose in ihrem Reich verschwinden lässt. Sie kann das Geld für
nötige Anschaffungen sehr gut gebrauchen.
Und dann räumt sie auf und bringt alles auf Vordermann, auch
den Gatten. Als Erstes sorgt sie dafür, dass Luthers halbverfaulte
Strohmatratze aus dem Schlafzimmer fliegt und außer einem neuen
Bett auch ein anständiges Kopfkissen angeschafft wird. Dann macht
sie nach und nach aus dem Refektorium, dem Essenssaal der Mönche,
'eine Riesenküche mit Brot-, Mehl- und Speisekammer, lässt einen
neuen Herd mauern und Rohrwasseranschlüsse legen. Ofen werden
150150 gesetzt, wurmstichige Balken erneuert, der unebene Lehmfußboden
begradigt. Wände, die winzige Mönchszellen trennten, lässt sie nie-
derreißen und neue errichten, um größere Wohnräume zu schaffen,
auch werden Treppen neu gebaut und das Ganze unterkellert. Eine
Waschküche findet neben den Vorräten dort Platz, später wird sie zu
einer richtigen Badestube erweitert. Die berühmte Lutherstube aber,
Ort der Tischgespräche, Wohnzimmer und Treffpunkt von Familie,
Studenten und Freunden, wird erst zehn Jahre nach dem Einzug fer-
tig werden, nachdem die Stadt endlich das hierfür notwendige Bau-
holz genehmigt hat.
Das Schwarze Kloster zu Wittenberg ist nun auf Jahre eine Bau-
stelle, die viel Lärm macht und den armen Doktor in seiner Turmstube
peinigt. Verdrossen bemerkt er, dass Ehefrauen »ihren Männern, wenn
diese auch noch so sehr beschäftigt sind, viele unnötige Störungen«
bereiten. Die Baumaßnahmen Katharina Luthers aber verhelfen vie-
len Wittenberger Handwerkern zu Auftrag und Arbeit und verwandeln
das Gebäude nach und nach aus einem schäbigen, abgewirtschafteten
und baufälligen Kloster in einen ansehnlichen funktionalen - heute
würde man sagen: mittelständischen - Betrieb mit Wohnhaus und
Landwirtschaft drum herum. Und auch wenn ihm das manchmal alles
zu viel wird - Luther weiß ganz gut, was seine Frau da leistet und was
er an ihr hat, und er sagt es auch: »Meine Katharina macht aus diesem
verrotteten Kloster ein Paradies auf dieser dunklen Erd.«59
Auch den Garten legt die Lutherin gleich nach dem Einzug an,
noch im ersten Jahr. Und zieht dort alles selbst, was sie für die Küche
braucht, Salat und Kräuter, Kürbisse und Melonen, Äpfel und Kir-
schen, Pfirsiche und Aprikosen, Brombeeren und Himbeeren, Son-
nen- und Mohnblumen - sie sät und gräbt und pflanzt und erntet. Ein
kleiner Wingert wird angelegt, und auch das Bier braut sie selber. So-
gar Bienen schafft sie an, um an Honig zu kommen; aus dem Wachs
zieht sie Kerzen.
Fehlen noch die Tiere, die Hof und Ställe in wachsender Zahl
bevölkern, um den Bedarf der Wirtschaft zu decken: Im -Jahr 1542
151
fünf Kühe neun Kälber, eine Ziege mit zwei Zicklein, acht
und drei Ferkel, außerdem Pferde, Hühnelß GänSC› EH*
und Tauben zum Bestand gezählt - so ist esıauf einer šY0ß@n
im Lutherhaus verzeichnet. Auch einen Fıschteich hat Ka-
Luther angelegt, später wird sie ein Stuck Land hinzukaufen,
das ein kleiner Fluss fließt, der Hechte, Forellen und Fluss-
spendet. Einen Hund gibt es im Hause Luther auch, TOIPC1
Namen, ein Spitz, aber der gehört zur Familie; alle anderen Tiere
das Ihre zum Unterhalt der Hausgemeinschaft bei.
In Wittenberg gibt es niemanden, der mehr Land oder mehr Viíh
Für Luther unerklärlich, denn ihm scheint, dass »ich me Y
als ich einnehme<<6°. Doch manchmal ist das Geld so knapp,
allem wenn Katharina Luther mal wieder Land gekauft hat, dass
beispielsweise vom 24. August bis zum 19. Oktober »kein Bier
Haus (hat) und kein Geld, welches zu kaufen<<, 50 notiert es em
etwas frustrierter Gast am 19. Oktober 1540. Doch im Großen
(`anzen sieht Luther keinen Grund, sich über Käthes Haushal-
zu beklagen, der er den ganzen Wohlstand zu verdanken hat: >›In
Dingen füge ich mich Käthe«, Sagt GY daher, nlßht Ohne
Seine - höhere - Sphäre hinzuweisen: ››Im Übrigen regiert mich
Heilige Geist.«61 Fragt sich nur wie diese Frau das alles schafft? »Ich muss mich in
Teile zerlegen, an sieben Orten zugleich sein und siebenerlei
verwalten Ich bin erstens Ackerbürgerin, zweitens Bäuerin,
Köchin, viertens Kuhmagd, fünftens Gärtnerin, sechstens
und Almosengeberin an alle Bettler in Wittenberg, sieben-
aber bin ich die Doktorissa, die sich ihres berühmten Gatten
zeigen und mit 200 Gulden J ahresgehalt viele Gäste bewirten
listet die Lutherin wie sie überall genannt wird, selbst nicht
Witz all ihre Berufe auf. Gleichzeitig gibt sie ein Zeugnis ihrer
Tüchtigkeit, die einem Angst und Bange machen kann. “ Historiker haben Katharina Luthers Tagesablauf rekonstruıer
und 'ruf dieselbe Tafel im Lutherhaus geschrieben, die schon den
152153 Viehbestand im Jahr 1542 aufführt: Danach steht die inzwischen
43-jährige Mutter von fünf Kindern morgens früh um vier auf, um
das Frühmahl zu bereiten. Anschließend wird die Morgenandacht im
Kreis aller Hausgenossen gehalten. Dazu gehören inzwischen eine
große, wechselnde Anzahl von Studenten, an die sie Zimmer vermie-
tet, um die Haushaltskasse zu füllen. Zudem haben die Luthers außer
den eigenen fünf noch 12 Pflegekinder von verstorbenen Angehöri-
gen dauerhaft aufgenommen und beherbergen kurzfristig noch vier
Kinder von Eltern, die durch die Pest umkommen. Katharinas Tante
Magdalena, »Muhme Lene<<, wohnt im Schwarzen Kloster ebenso wie
Luthers Famulus (eine Art wissenschaftliche Hilfskraft) Wolf Sieber-
ger. Und zehn Haus-angestellte helfen, den Betrieb am Laufen zu hal-
ten: ein Verwalter, ein Hauslehrer für die Kinder, eine Köchin, ein
Kutscher, ein Schweinehirt und fünf Knechte und Mägde.
››Im Haus des Doktors wohnt eine wunderlich gemischte Schar
aus jungen Leuten, Studenten, jungen Mädchen, Witwen, alten Frau-
en und Kindern, weshalb große Unruhe im Haus ist, deretwegen viele154 Leute Luther bedauern<<63, bemerkt ein Zeitgenosse aus Wittenberg
- Katharina Luther, die die ganze Arbeit hat, bedauert offensicht-
lich niemand. Die Gäste geben sich die Türklinke in die Hand, bedeu-
tende und weniger bedeutende und solche, die gleich auf Monate oder
Jahre bleiben: ehemalige Nonnen, die nicht mehr zu ihren Familien
zurück können, andere politisch religiöse Flüchtlinge wie die Landes-
fürstin Elisabeth von Brandenburg, die sich gegen den Willen ihres
Mannes der Reformation anschließt. Natürlich sitzt auch der gesamte
Wittenberger Freundeskreis häufig am Tisch. Alle essen und trinken,
brauchen eine Schlafstatt und vieles mehr - die Lutherin hat täglich
sage und schreibe bis zu 60 Personen zu versorgen. Selbst mit der
Hilfe von Dienstboten ein schier mörderisches Pensum.
Nach der Morgenandacht mit all den gerade genannten Leuten ist
es erst sieben Uhr. Jetzt setzt Katharina sich hin und macht einen ge-
nauen Plan, was an Arbeit in Küche, Ställen und Gärten in den nächs-
ten 3 Stunden erledigt werdein muss, und zwar von ihr persönlich - so
steht es zumindest auf dieser Tafel: Sägen und Hacken von Brenn-
holz, Kerzenziehen, Getreide mahlen und schroten, Brot backen, Bier
brauen und Gerste kochen; um Malz zu gewinnen, Butter und Käse
herstellen, nach dem Vieh schauen und schlachten, das Fleisch halt-
bar machen, also pökeln, dörren und räuchern.
Weinbau und Gartenarbeit komplettieren das Programm, Arbei-
ten, die aber je nach Jahreszeit sehr unterschiedlich ausfallen und im
Winter wohl kaum Zeit beansprucht haben dürften. Aber nun stehen
noch Waschen, Nähen, Flicken und Stopfen auf ihrer Agenda sowie
die Zubereitung von Heilmitteln, also Salben, Tränklein und Tees für
die Kranken oder für die Hausapotheke. Auf den Markt wird sie auch
noch gehen müssen, um das wenige zu kaufen, was ihr eigener Betrieb
nicht herstellt. Und schließlich heißt es noch Míttagsmahl kochen.
Das gibt es um zehn. Danach ist eine kurze Ruhepause, dann wird .
die Liste weiter abgearbeitet bis nachmittags um fünf. Da geht's zum
Abendessen, anschließend hält man wieder eine Andacht und geht
um neun zu Bett. Man sieht, die Luthers haben den alten Kloster-
155 rhythmus beibehalten. Dazwischen aber findet der sogenannte Feierabend statt, seit 1535 wohl hauptsächlich in der Lutherstube, mit
Unterhaltung, Gesang und Lautenspiel im großen Kreis der Hausge-
nossen und Gästen wie die Tafel vermerkt.
Ein praller Arbeitstag, und das wahrscheinlich 365-mal im Jahr.
Luther notiert anerkennend: »Meine Käthe ist der Morgenstern von
Wittenberg. Sie steht auf morgens in der Früh um vier Uhr, fuhr-
werkt, bestellt das Feld, weidet und kauft Vieh, braut und so weiter.« 64
Dazu kommen noch sechs Schwangerschaften in acht Jahren, von
ihnen soll gleich noch die Rede sein.
Aber noch mal zurück zu den Anfängen dieses so produktiven Un-
ternehmens, den ersten Wochen und Monaten der Ehe von Katha-
rina und Martin Luther. Auch da sind ihre Eindrücke und Empfin-
dungen leider nicht überliefert; er aber notiert: »Das erste Jahr einer
Ehe macht einem Ehemann seltsame Gedanken. Sitzt er am Tisch, so
denkt er: Früher warst du allein, jetzt selbander. Beim Erwachen sieht
er zwei Zöpfe neben sich liegen, die er früher nicht sah.<<65
Wäre die Luther-Ehe als unglücklich bekannt, könnte man hier
vielleicht eine gewisse Skepsis heraushören. Aber das Gegenteil ist
der Fall: Viele seiner Worte - und die wenigen von ihr - geben Anlass
zu der Vermutung, dass sich Martin und Katharina nicht nur respek-
tieren, sondern auch sehr gern haben: »Ich bin nicht 'leidenschaftlich
verliebt, aber ich habe mein Weib lieb und wert«66, sagt er nach seiner
Heirat.
Die beiden Zöpfe, die Luther beim Erwachen nun neben sich sieht -
sie sind das Bild dafür, wie sehr die Ehe sein Leben verändert hat: das
Staunen darüber, dass da nun plötzlich noch jemand ist, eine junge
Frau, die man vor Kurzem noch gar nicht kannte, und die jetzt mit
einem im Bett liegt und friedlich schläft. Und der Mann daneben, der
lange, nein, immer allein war des Nachts, kann es kaum glauben, dass
die Trägerin dieser Zöpfe von nun an immer da ist und sechs Kinder
mit ihm bekommt, bis dass der Tod sie scheidet.
J Diese Vernunftehe wird besser halten als so manche Liebesheirat156 in späteren, romantischeren Zeiten und wird auch dadurch Vorbild-
charakter bekommen. ››Ich wollte meine Käthe nicht um Frankreich
. und um Venedig dazu hergeben!<<67, sagt Luther und klingt nach ei-
nem Ehemann, der es doch alles in allem recht glücklich mit seiner
Frau getroffen hat. Auch wenn es in der Ehe nicht allezeit schnur-
leicht zugehe. Und nicht nur Generationen evangelischer Pfarrer
werden sich an den Luthers orientieren; mit Martin und Katharina
wird die Ehe, die vordem nur etwas für den Adel und betuchte Bürger
war, als Lebensform weit über die protestantischen Kreise hinaus für
alle Menschen populär. „
"Das »schönste Ehepfand« sind für Martin Luther aber die Kinder.
Und er frohlockt: »Ich habe eheliche Kinder, die hat kein papistischer
Theologe.<<68 Er ist ein engagierter Vater, der von unterwegs nicht
nur Katharina schreibt, sondern auch den Kindern und ihnen klei-
ne Geschichten erzählt. Wenn er nach Haus zurückkommt, bringt er
Zuckerwerk und Spielzeug mit. Drei Söhne und drei Töchter bringt
Katharina in nur acht Jahren zur Welt. In den Abendstunden sind die
Kinder bei der großen Gesellschaft der Hausgenossen mit dabei, der Vater findet Zeit, sich mit ihnen. zu beschäftigen, denn »sollen wir
Kinder erziehen, müssen wir Kinder mit ihnen werden« 69, befindet
er und zeigt damit, wie ernst es ihm damit ist, seine Kinder zu ver-
stehen. Auch wenn er tagsüber manchmal streng sein muss, wenn sie
ihn beim Arbeiten stören: »Wenn ich sitze und schreibe, so kommt
das Hündchen Tölpel über meine Briefe, und mein Hänschen singt
mir ein Liedlein daher; wenn er's zu laut will machen, so fahre ich
ihn ein wenig an, so singt er gleichwohl fort, aber er machet's heimli-
cher und etwas mit Sorgen und Scheu.<<7° Auch seine Strenge klingt
weniger autoritär, als man es für seine Zeit erwartet. Es ist bekannt:
dass der Vater seine Kinder nie schlägt, so wie er von seinem stren-
gen Vater geschlagen worden ist. Dennoch ist auch für Martin Luther
die Rangfolge eindeutig: Erst kommt Gott, dann der Fürst, dann der
Mann, nach ihm die Frau und dann erst die Kinder.
Doch Hänschen, das älteste Kind, macht als Jugendlicher seier soll. 157 Die einen Eltern Kummer, weil er zu Hause nicht so lernt, wie
Eltern schicken ihn daher in die beste Lehranstalt des Landes nach
Torgau zu Schulmeister Markus Crodel, wo er vor allem in Latein,
Grammatik und den guten Sitten unterwiesen werden soll. Doch
dann erkrankt seine jüngere Schwester Lene schwer - die Tochter,
die nach dem Tod der kleinen Elisabeth, die ihnen
nicht erlebt, als drittes Kind geboren worden ist. Die Luthers rufseın
Johannes zurück nach Wittenberg, weil Lene nach ihm verlangt. >> ie
sehnt sich so danach, ihren Bruder zu sehen, daß ich einen Wagen
schicken muss. Sie haben einander sehr lieb gehabt«, schrelbt Luthef
an Crodel. »Lass ihn also mit dem Wagen hierher fliegen, äbef V_eY'
schweige ihm den Grund vielleicht kann Lenchen sich durch seine
Ankunft wieder etwas erholen.<< 71 _ d
Doch das kann sie nicht. Magdalene stirbt mit 13 Jahren. Un
zwar in den Armen des Vaters, nicht der Mutter, die den Schmem
der sie überwältigt, vor dem sterbenden Kind verbergen will: »Kälthí
war in derselben Kammer, doch weiter vom.Bette um der TraurigMei
willen« 72, schreibt Luther auf. Schon bei Elisabeths Tod mit acht o-
naten empfindet der Vater große Trauer, über die er fast ein wenig
verwundert notiert: ››Das hätte ich nie zuvor gedacht, dass ein va-
`terliches Herz so weich werden könnte, wegen der Kinder.<<73 Doch
bei Lieblingstochter Lene sind beide Eltern so untröstlich, dass ihnen
nicht einmal ››der Tod Christi« hilft, »wie es doch sein sollte« 74. Bei
der Trauerfeier fällt Martin Luther auf die Knie und weint bitterlich.
Doch sind ja außer Johannes noch die drei jüngeren Kinder im Haus,
die beiden Buben Martin und Paul und die Jüngste Tochter Marga'
rethel sie werden die Eltern im Lauf der Zeit wohl trösten.
Vier Jahre später geht es auch mit Martin Luther zu Ende. Nach
dem Tod von Lene haben seine Depressionen wieder Zllgenommená
auch plagen ihn unzählige andere Leiden wie die Gicht, Gallen-dun
BlasensteinefMagenprøbleme, V@1'$t0Dfl1ng› Bluthochdfllck un em
schwerer Tinnitus - wohl die Folgen V0“ Fasten und lahrelangem
Schlafmangel während seines Klosterlebens, das seine Gesundheit
158158 früh ruiniert hat. Er stirbt am 18. Februar 1546 in Eisleben. Katha-
rina trifft die Nachricht ins Herz, seine so viel jüngere Frau wird ihn
nur um sechs Jahre überleben.
Bei der Trauerfeier am 22. Februar sind außer Katharina Luther
und den vier Kindern und den Freunden auch Hofbeamte, Wittenber-
ger und die ganze Universität dabei. Bugenhagen und Melanchthon
halten die Traueransprachen zu Ehren des verstorbenen Reformators.
Die Witwe findet darin mit keinem einzigen Wort Erwähnung.
Dabei ist sie diejenige, die der Verlust Luthers am meisten trifft.
Wie schlecht es ihr noch zwei Monate nach seinem Tod geht, wissen
wir aus einem ihrer wenigen erhaltenen Briefe: ››... wer sollte nicht
billig betrübt und bekümmert sein wegen eines solchen teuren Man-
nes, wie es mein lieber Herr gewesen ist, der nicht allein einer Stadt
oder nur einem Land, sondern der ganzen Welt viel gedient hat. Des-
wegen bin ich wahrhaftig so sehr betrübt, daß ich mein großes Her-
zeleid keinem Menschen sagen kann und ich weiß nicht, wie mir zu
Sinn und zu Mut ist. Ich kanncweder essen noch trinken. Auch dazu
nicht schlafen. Und wenn ich ein Fürstentum oder Kaisertum gehabt